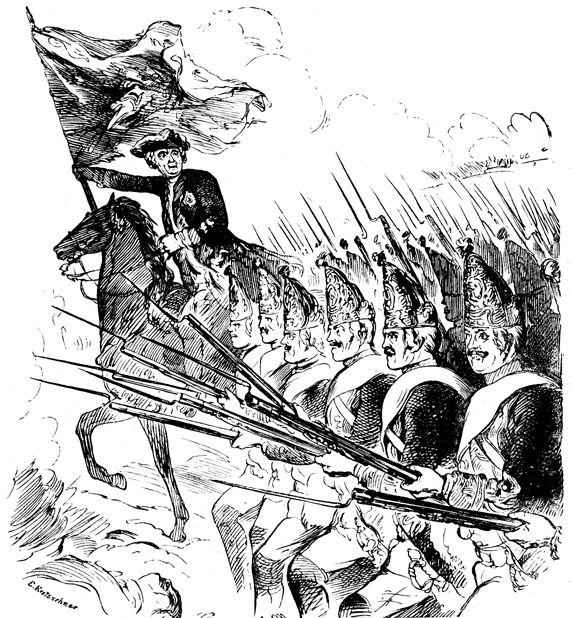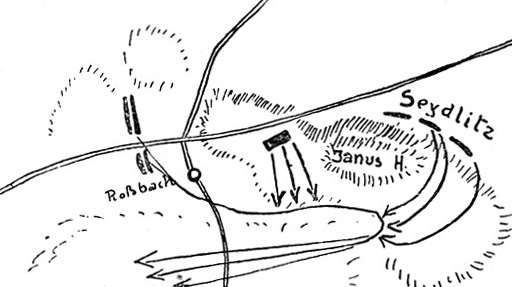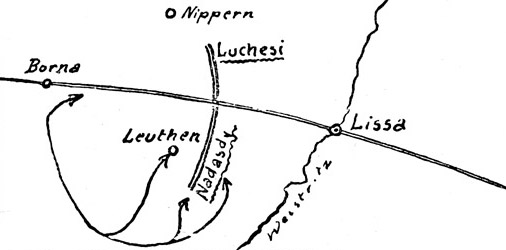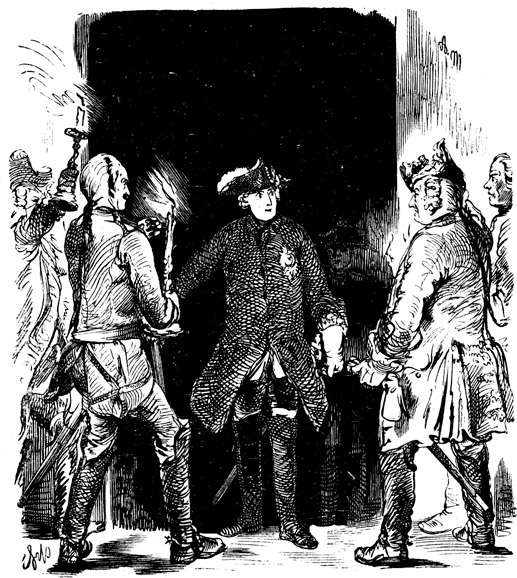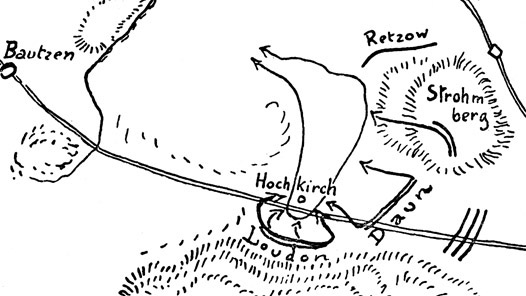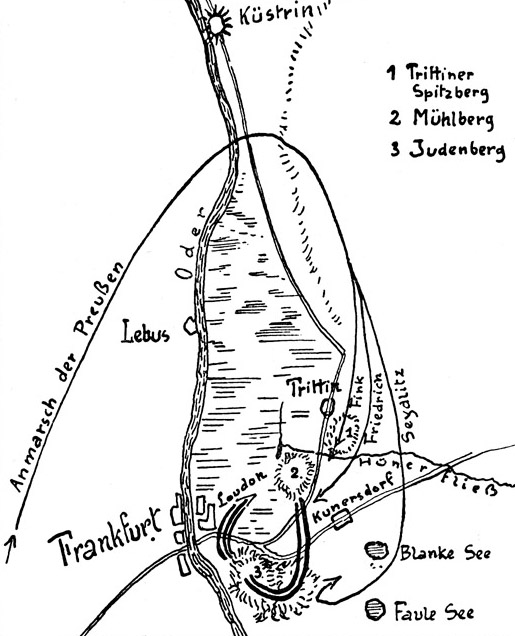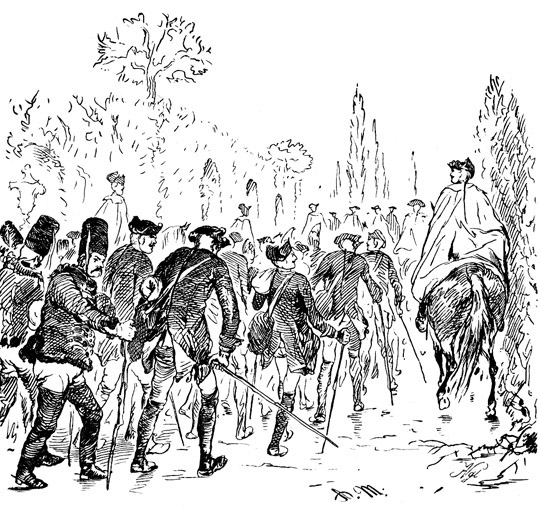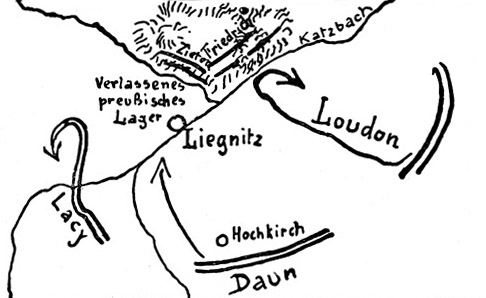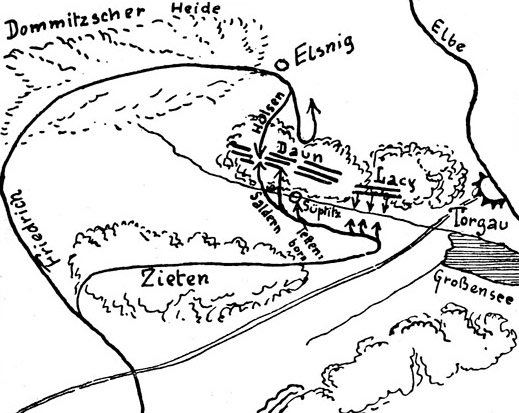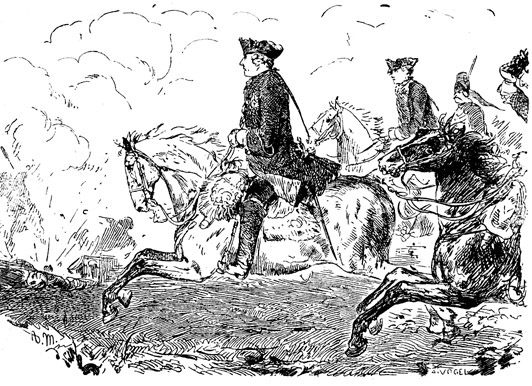Buch:Aus dem Siebenjährigen Kriege: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ru:Книга:Из_Семилетней_войны]] | [[ru:Книга:Из_Семилетней_войны]] | ||
[[Datei:AADSK.jpg|mini]] | |||
von [[Johann Wilhelm von Archenholz]] | von [[Johann Wilhelm von Archenholz]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Januar 2025, 02:06 Uhr
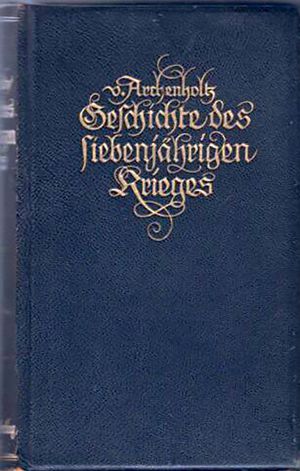
von Johann Wilhelm von Archenholz
nach den neuesten Forschungsergebnissen umgearbeitet von v. Duvernoy, Kgl. Württ. Oberstleutnant a. D.
Mit Federzeichnungen von Adolph von Menzel
Verlegt bei Hermann Schaffstein Verlag in Köln a. Rh.
Siebzehntes der Grünen Bändchen herausgegeben von Nicolaus Henningsen
Zusammenfassung
In "Aus dem Siebenjährigen Kriege" von Johann Wilhelm von Archenholz wird der Leser in die turbulenten Zeiten des 18. Jahrhunderts und des Siebenjährigen Krieges eingeführt. Archenholz präsentiert detaillierte Berichte über die Schlachten und politischen Intrigen dieser Ära und gibt dem Leser einen Einblick in das Leben der Soldaten und der Zivilbevölkerung. Sein Schreibstil ist präzise und informativ, ohne dabei den historischen Kontext aus den Augen zu verlieren. Das Buch wird oft als eines der besten Werke über den Siebenjährigen Krieg angesehen und bietet eine wertvolle Quelle für Historiker und Interessierte gleichermaßen. Johann Wilhelm von Archenholz war ein preußischer Autor und Historiker, der selbst als Offizier am Siebenjährigen Krieg teilnahm. Seine persönlichen Erfahrungen und sein tiefes Verständnis der Kriegsführung spiegeln sich in seinen detaillierten Darstellungen im Buch wider. Archenholz war bekannt für seinen akribischen Forschungsstil und seine objektive Herangehensweise an historische Ereignisse, was zu seiner Glaubwürdigkeit als Historiker beitrug. 'Aus dem Siebenjährigen Kriege' ist ein unverzichtbares Werk für alle, die sich für Militärgeschichte und das 18. Jahrhundert interessieren. Mit seiner fesselnden Darstellung der Ereignisse und der klugen Analyse von Schlachten und politischen Entscheidungen wird dieses Buch Leser aller Art ansprechen und sie in die faszinierende Welt des Siebenjährigen Krieges eintauchen lassen.
Vorwort
Der alte »Archenholtz« ist in einer neuen Form aufgetaucht. Mehr als hundert Jahre ist er alt, und in diesen 100 Jahren hat die Forschung auch über den Siebenjährigen Krieg manche neuen Tatsachen zutage gefördert, so daß vieles, was bisher als Tatsache galt, weichen muß. Oberstleutnant a. D. v. Duvernoy hat die Bearbeitung nach den Ergebnissen der neueren Forschung, besonders in der Kriegsgeschichtlichen Abteilung II des Großen Generalstabs, der ja sämtliche europäischen Archive für diesen Zweck zur Benutzung offenstehen, ausgeführt. Es ist ein Beweis für die Güte des alten Archenholtz, daß er die Änderungen vertragen konnte und doch »er selbst« geblieben ist. So vereint das nun entstandene Werk in sich den Wert eines Quellenbuches mit dem wissenschaftlicher Zuverlässigkeit.
Das Original, im Verlage C. F. Amelang, Leipzig, ist etwa sechsmal so stark wie dieser Auszug, zu dem der Verlag freundlichst Erlaubnis gab. In den Text dieses Bändchens sind außer 11 Menzel-Bildern Skizzen folgender sechs Schlachten eingestreut: Roßbach, Leuthen, Hochkirch, Kunersdorf, Liegnitz, Torgau. Um der Menzelschen Zeichnungen willen ist an zwei Stellen kurzer Text aus F. Kuglers »Geschichte Friedrichs des Großen« eingeschaltet worden.
Der Herausgeber.
Erster Teil: 1756
König Friedrich von Preußen hatte bereits in jungen Jahren zwei Kriege geendigt, durch die er sich mit Lorbeeren gekrönt hatte. Seitdem waren die Augen aller Nationen auf ihn gerichtet, dessen hohe Geistesgaben allgemeine Bewunderung hervorriefen; aber auch der Neid und die Mißgunst so manchen Staates war erregt worden. So entstand ein Krieg, der zu den außerordentlichsten gehört, die jemals die Erde verwüstet haben. Er war dies sowohl in Ansehung der großen Menge der Armeen von so verschiedenen Volksstämmen und Sprachen, als auch der erstaunlichen Ungleichheit der beteiligten Mächte, der Feldherren und ihrer Taten. Er war dies ferner in bezug auf die dabei angewandte verfeinerte Kriegskunst, auf die blutigen Schlachten und Belagerungen zu Lande und zu Wasser, auf die sonderbaren Begebenheiten so mannigfacher Art und auf die Ausdehnung in allen Weltteilen und Meeren.
Schlesien, ein schönes, mit arbeitsamen Einwohnern bevölkertes Land, das Friedrich II., König von Preußen, gleich nach seiner Thronbesteigung erobert und mit dem Schwerte sowohl im Breslauer als im Dresdener Frieden behauptet hatte, war ein zu großer Verlust, als daß er so leicht von der Kaiserin-Königin Maria Theresia verschmerzt werden konnte. Sie war gezwungen worden, es dem Sieger zu überlassen, – einem Monarchen, der wegen seines beschränkten Staatenbesitzes nicht als furchtbar geachtet wurde. Es erschien leicht, das verlorene Land durch mächtige Verbindungen wieder zu erobern. Maria Theresia war bereits seit 1746 mit Rußland verbündet. Kaunitz, den sie 1753 zum Reichskanzler ernannt hatte, befürwortete ein Bündnis mit Frankreich und einen Rachekrieg gegen Preußen. Als Botschafter in Paris war es ihm gelungen, die Marquise v. Pompadour, die sich durch ihr hinterbrachte spöttische Äußerungen Friedrichs beleidigt fühlte und damals die Rolle einer politischen Beraterin Ludwigs XV. spielte, für seine Pläne zu gewinnen. Seit dem Frühjahr 1755 war der Krieg in Amerika zwischen Frankreich und England in vollem Gange. König Georg II. von England, der um sein Kurfürstentum Hannover besorgt war, war Preußen in neuester Zeit auffallend entgegengekommen. Ende 1755 erklärte er sich bereit, mit Preußen engere Verbindungen einzugehen. Da Friedrich allmählich an die Sicherheit Preußens denken mußte, so entschloß er sich zum Abschluß eines Bündnisses mit England am 16. Januar 1756, bekannt unter dem Namen: Vertrag zu Westminster. Kaunitz gelang es, dieses Bündnis in Paris wie in Petersburg als kriegslustige Gesinnung Friedrichs darzustellen, und am 1. Mai schlossen Österreich und Frankreich einen Vertrag, worin sich beide Mächte ihren derzeitigen Besitz gewährleisteten. Frankreich versprach, der Kaiserin-Königin ein Hilfskorps von 24 000 Mann zu stellen; dieses wuchs bald zu weit über 100 000 Streitern an.
Der Haß, den die Zarin Elisabeth gegen Friedrich hegte, war ebenfalls durch hämische Äußerungen dieses zu Spöttereien äußerst geneigten Monarchen hervorgerufen. Im Februar 1757 beschloß eine russische Staatskonferenz, Österreich zu erklären: Rußland sei bereit, Preußen mit 80 000 Mann anzugreifen, falls Theresia dasselbe tun wolle, und die Waffen nicht vor der Wiedereroberung Schlesiens niederzulegen.
Rußland wird »das königliche Preußen erobern und es Polen im Austausche gegen Kurland und andere Grenzgebiete abtreten«, Sachsen und Schweden sind zur Teilnahme aufzufordern und ihnen dafür Magdeburg bzw. Pommern zu versprechen.
Der Untergang Friedrichs durch dieses Bündnis wäre ganz unvermeidlich gewesen, wenn er nicht durch die Verräterei eines sächsischen Kanzleisekretärs Nachricht von der ihm drohenden Gefahr erhalten hätte. Dieser Mensch, namens Mentzel, lieferte dem preußischen Gesandten in Dresden die Urschriften der geheimsten Depeschen zur Abschrift aus. Die zeitige Entdeckung der politischen Entwürfe verringerte die Gefahr eines Fürsten außerordentlich, der auf eine bisher in Europa noch nie erhörte Art mitten im Frieden beständig zum Kriege vorbereitet war, der das große Talent eines Heerführers in einem seltenen Grade besaß, der 160 000 Mann der geübtesten Soldaten und eine reichlich gefüllte Schatzkammer hatte. Diese Vorteile wußte sein großer Geist aufs beste zu nutzen, als sich der Wiener Hof wiederholt weigerte, ihm auf eine bestimmte Art die verlangten Friedensversicherungen zu geben. Ja, als der preußische Gesandte die verratenen Geheimnisse aufdeckte, erhielt er nicht allein die unfreundlichsten Antworten, sondern es wurde alles abgeleugnet. Nun entschloß sich König Friedrich schleunigst, seinen Feinden zuvorzukommen, und griff selbst zuerst zum Schwerte. Friedrich hatte kein anderes Mittel, sich aus der ihm drohenden Gefahr zu retten oder sie abzuschwächen, als sie selbst aufzusuchen.
Die Bundesgenossen hatten damals ihre Zurüstungen kaum angefangen, es fehlte allenthalben an Geld, und die zum Kriege bestimmten Truppen lagen noch größtenteils ruhig in ihren Standquartieren, als der König von Preußen im Monat August 1756 sich wie ein Riese von seinem Lager erhob und mit 67 000 Mann in Sachsen einfiel. Die Besitznahme dieses Landes war ihm zum Eindringen in Böhmen durchaus notwendig, auch wurde er dadurch Meister von der Elbe und ihrer Schiffahrt, ein Umstand, der ihm große Vorteile gewährte. Alle sächsischen Korps zogen sich in größter Eile zurück, und die wichtigen Städte Wittenberg, Torgau und Leipzig wurden ohne Widerstand eingenommen.
Dieser folgenschwere Schritt war begleitet von einer Schrift zu seiner Rechtfertigung, abgefaßt von Friedrichs eigener Hand, und von einer Erklärung seines Gesandten am sächsischen Hofe über die Notwendigkeit seines Durchzuges nach Böhmen. Er hatte keinen Verbündeten als den König von England, und die Vorteile dieses Bündnisses zeigten sich noch sehr in der Ferne. Die Rettung des preußischen Monarchen hing also ganz allein von der Geschwindigkeit und dem Nachdrucke seiner Kriegsoperationen ab.
Sobald man in Dresden die erste Nachricht vom Aufbruche der Preußen erhielt, war die Bestürzung des Hofes außerordentlich. Die sächsischen Truppen standen seit Ende August in ihren Standorten bereit, im Fall eines preußischen Einmarsches mit etwa 20 000 Mann ein Lager unweit Pirna zu beziehen. Dieses Lager war an die Elbe gestützt, die sich hier zwischen Felsen brausend hindurchwindet. In der Nähe liegen sowohl die Festung Königstein als das Fort Sonnenstein und eine Kette hoher Berge und schroffer Felsen. Überhaupt war dessen Lage von Natur außerordentlich stark, und die Kunst tat das übrige, um es unbezwinglich zu machen. Dies Lager wäre sehr wohl gewählt gewesen, wenn man den Österreichern den Eingang in Sachsen hätte verwehren wollen, allein den Preußen gab man durch seine Wahl Dresden und das ganze Kurfürstentum preis. Dabei war der Umfang des Lagers für die sächsische Armee zu groß, man begnügte sich daher, nur die ohnehin schweren Zugänge durch Verhacke und Palisaden noch mehr zu befestigen. Man dachte aber bloß sich gegen das Schwert der Preußen in Sicherheit zu setzen, und vergaß darüber einen weit fürchterlicheren Feind von dem Lager zu entfernen, einen Feind, der seit Jahrtausenden so viele Heere besiegt, so viele große Feldherren zur Flucht gebracht, oft die größten Siege vereitelt und die langwierigsten Kriege auf einmal geendigt hat: den Hunger. Man versah sich mit Palisaden, aber nicht mit Brot.
Indessen war Friedrich in Sachsen eingetroffen und hatte mit dem Könige von Polen Der König von Polen war zugleich Kurfürst von Sachsen. einen Briefwechsel angefangen. August, der sich mit seinen beiden ältesten Prinzen und von seinem Minister Brühl begleitet ins Lager bei Pirna geflüchtet hatte, sprach immer in diesen Briefen von Neutralität, Friedrich dagegen von überzeugenden Beweisen, die zu geben jedoch August und Brühl sehr weit entfernt waren. Indessen traf König Friedrich alle Anstalten, sich in Sachsen zu behaupten, und rückte am 10. September ohne Widerstand in das von allen Truppen entblößte Dresden ein und besetzte die Stadt und das königliche Schloß. Er traf alle Maßregeln, um das scheußliche Bild des Krieges in den Augen der bestürzten Sachsen weniger schrecklich zu machen und den neuen Gebieter in einer liebenswürdigen Gestalt zu zeigen. Auch ließ er durch den Feldmarschall Keith die Königin und die übrige königliche Familie begrüßen. Ungeachtet dieser Aufmerksamkeiten, die aufs artigste erwidert wurden, wurden in Dresden die Kanzleien versiegelt, die Münzabteilung aufgehoben, einige der vornehmsten Beamten ihrer Dienste entlassen, die ganze Artillerie nebst der Munition aus dem Zeughause der Residenz nach Magdeburg gebracht und im ganzen Lande die kurfürstlichen Kassen in Beschlag genommen. Dabei wurde alle Verbindung zwischen Dresden und dem sächsischen Lager abgeschnitten. Das Lager von Pirna selbst war anfangs von 38 000 Preußen eingeschlossen, während eine andere ungefähr ebenso starke preußische Armee unter Anführung des Feldmarschalls Keith mit der Front gegen Böhmen aufgestellt war, um die etwa ankommenden Hilfstruppen zu beobachten.
Obgleich das zum Untergange des Königs von Preußen entworfene Bündnis diesem Monarchen verraten worden war und er auch Abschriften vieler wichtiger Papiere hatte, so war doch noch manches dunkel geblieben. Die genaue Kenntnis der gemachten Entwürfe war ihm aber zu seiner Selbsterhaltung äußerst nötig, und hierzu kam die politische Pflicht, seinen Einfall in Sachsen, der alle europäischen Höfe in Erstaunen setzte, durch unverwerfliche Urkunden zu rechtfertigen. Er sah sich daher genötigt, sich des sächsischen Archivs zu bemächtigen. Dieses Staatsheiligtum wurde in drei Gemächern des königlichen Schlosses aufbewahrt, die mit einem Privatzimmer der Königin von Polen zusammenhingen. Sie selbst hatte dazu allein den Schlüssel und bewachte das Archiv wie den kostbarsten Schatz. Das Ansuchen Friedrichs, es auszuliefern, schlug daher diese Fürstin, seine erklärte Feindin, rund ab. Der preußische General Wylich, Kommandant von Dresden, hatte jedoch gemessene Befehle, es in Besitz zu nehmen, und schickte den Major Wangenheim mit diesem Auftrage ab. Wangenheim ließ sich die Schlüssel ausbitten, worauf die Königin selbst erschien und nachdrücklich erklärte, daß sie keine Eröffnung erlauben würde. Der Major entfernte sich, und nun begab sich der Kommandant selbst zur Königin. Alle seine Vorstellungen waren vergebens, sie beharrte fest bei ihrem Entschlusse, wobei sie drohte, die Eingangstür durch ihren Körper zu decken. Wylich warf sich vor ihr auf die Knie, sprach von der Notwendigkeit, die Befehle seines Monarchen unbedingt und ohne Verzug zu befolgen, und indem er sie beschwor nachzugeben, gab er zu verstehen, daß er im äußersten Falle Gewalt brauchen müßte. Hierauf wurden die Schlüssel gebracht, und Friedrich erhielt die gewünschten Papiere. Sie wurden dem Geheimen Rat Grafen Hertzberg überliefert, der daraus jene merkwürdigen Staatsschriften verfertigte, die des preußischen Monarchen Schritte bei den Unbefangenen aller Nationen vollkommen entschuldigten.
Alle Versuche, zwischen den Königen von Preußen und Polen einen Frieden zustande zu bringen, waren vergebens. August forderte bald nach seiner Ankunft im Lager bei Pirna seine Truppen durch eine eindringliche Rede auf, sich mit ihm trotz der Macht des Feindes nach Böhmen durchzuschlagen. Man bewies ihm aber die Unmöglichkeit, diesen Entwurf auszuführen, worauf er sich mit seinen Prinzen und dem Minister nach der Festung Königstein begab. Von hier aus sandte er eine neue Aufforderung an seine Armee, worin er sie bat, die Ehre ihres Königs zu retten und sich bis auf den letzten Blutstropfen zu verteidigen. Die getreuen Sachsen waren auch bereit, sich für ihren König aufzuopfern; aber der Mangel herrschte in ihrem Lager bald so sehr, daß der für Menschen und Pferde bestimmte Unterhalt um ein Drittel vermindert werden mußte. Ihr Mut wuchs jedoch, als sie von der Annäherung der österreichischen Armee hörten, die damals, obwohl in zerstreuten Korps, schon über 70 000 Mann in Böhmen stark war.
Der Wiener Hof entfaltete eine außerordentliche Tätigkeit, den Krieg anzufangen. Ein großer Teil der Kavallerie in Böhmen war jedoch noch unberitten und erhielt die Pferde erst am Ende des August, im Lager bei Kolin, zu einer Zeit, da die Preußen sich schon im Königreiche befanden. Ja, man war noch so wenig zum Kriege vorbereitet, daß es sogar an Pferden fehlte, die Artillerie und Munition nach Böhmen zu schaffen. Theresia öffnete nun ihre Marställe und gab ihre eigenen Pferde her, um die Kanonen fortzubringen. Der österreichische und böhmische Adel wetteiferte, dies große Beispiel nachzuahmen. Man drängte sich von allen Seiten herbei, die Pferde zu liefern, und so wurde der Transport mit größter Geschwindigkeit erledigt.
Die kaiserlichen Truppen standen unter dem Kommando des Feldmarschalls Grafen Browne. Dieser hatte von seinem Hofe Befehl, alles zu wagen, um die Sachsen zu entsetzen. Friedrich mußte unter allen Umständen eine Vereinigung der Österreicher mit den Sachsen vermeiden, und er hatte bereits drei starke Korps unter Herzog Ferdinand von Braunschweig, Feldmarschall Keith und Feldmarschall Graf Schwerin nach Böhmen vorrücken lassen. Als er aber die Kunde erhielt, daß Browne in nördlicher Richtung abmarschiert sei, beschloß er, selbst nach Böhmen zu gehen. Er vereinigte sich dort mit den Truppen Keiths und des Herzogs Ferdinand von Braunschweig und rückte Browne entgegen.
Am 1. Oktober kam es bei Lowositz zur Schlacht. 28 000 Preußen standen 35 000 Kaiserlichen gegenüber. Die Preußen erstürmten nach einem furchtbaren Handgemenge mit Bajonett und Kolben den Ort Lowositz, und damit war die Schlacht zu ihren Gunsten entschieden. Die Österreicher gingen zurück. Die Verluste waren auf beiden Seiten nahezu gleich, rund 2850 Köpfe. In Wien ordnete man eine neuntägige Andacht für die Gefallenen an, wobei Witzbolde sagten: »Es ist ein Dankgebet, daß es uns noch erträglich gegangen ist.«
Die erste Schlacht dieses denkwürdigen Krieges währte von Tagesanbruch bis um 3 Uhr nachmittags und gab den Völkern der Erde gleichsam eine Bürgschaft der preußischen Taten für die folgenden Schlachten. Der König war vom Mute der Truppen so hingerissen, daß er in seinem Briefe an den Feldmarschall Schwerin die Worte braucht: »Nie haben meine Truppen solche Wunder der Tapferkeit getan, seitdem ich die Ehre habe, sie zu kommandieren.«
Browne zog auf dem rechten Ufer der Elbe unverfolgt nach Sachsen, in der Hoffnung, die Sachsen würden sich zu ihm durchschlagen. Diese versuchten auch, nachdem der Mangel aufs äußerste gestiegen, einen Durchbruch, aber ohne Erfolg. Die Österreicher waren fern, und nun lagen sie ohne Nahrung und Munition, überall vom Feinde umgeben, aller Hoffnung auf Rettung beraubt. Ihr Schicksal hing nun gänzlich von der Gnade des Siegers ab.
Zu der Zeit berief der sächsische Feldmarschall Graf Rutowsky die Generale zusammen, um ihnen zu eröffnen, daß er einen Angriff für ebenso aussichtslos, als undurchführbar halte. Man könne jetzt einzig hoffen, günstige Kapitulationsbedingungen zu erhalten. Die Generale stimmten sämtlich zu, und am nächsten Morgen nach anfänglichem Weigern auch der Kurfürst.
Die Bedingungen der Übergabe, die am 15. Oktober festgesetzt wurden, waren hart genug. Die ganze Armee, jetzt noch 18 000 Mann stark, mußte sich ergeben. Die Offiziere wurden entlassen. Den Unteroffizieren und Gemeinen aber ließ man keine Wahl; sie mußten dem Könige von Preußen den Eid der Treue schwören. Es war ein großes, rührendes Schauspiel: gegen 18 000 Krieger streckten die Waffen und flehten um Brot. Die Not war aufs höchste gestiegen, und die durch Mangel an Nahrung und durch Anstrengung ganz entkräfteten Soldaten erhielten sogleich das Nötigste aller Bedürfnisse. Jede Kompagnie bekam 20 sechspfündige Brote; die gefangenen Generale aber hatten die Ehre, an die Tafel des Königs von Preußen gezogen zu werden.
Das Unglück der Sachsen brachte ihnen keine Schande; vielmehr war es ein glorreicher Abschnitt in ihrer Geschichte. Sie hatten so lange mit ihrer kleinen Kriegsschar der preußischen Macht widerstanden, hatten mutvoll mit unaussprechlichen Widerwärtigkeiten gekämpft und waren nur den Gesetzen der Natur und einem höheren Verhängnisse unterlegen. Dieser Widerstand rettete das noch schlecht vorbereitete kaiserliche Heer in Böhmen und alle deutschen Provinzen Theresiens, wo die zerstreuten Truppen nacheinander leicht aufgerieben worden wären.
Von den sächsischen Truppen blieben 10 Infanterieregimenter ganz beisammen, nur mit dem Unterschiede, daß sie preußische Uniformen, Fahnen und Befehlshaber bekamen; die übrigen aber nebst der sämtlichen Kavallerie wurden unter preußische Regimenter gesteckt. Hierzu kamen 9284 Rekruten, die Sachsen gleich in den ersten Monaten zur Ergänzung der Regimenter liefern mußte. Die Offiziere wurden auf ihr Ehrenwort, in diesem Kriege nicht wider den König von Preußen zu dienen, freigelassen. So groß war jedoch Theresias und Augusts Haß gegen Friedrich, daß dieses Ehrenwort verspottet wurde. Man sagte die sächsischen Offiziere von dessen Haltung gänzlich los und schändete dadurch den Kriegerstand.
Diese Handlung Friedrichs, das ganze Heer eines fremden Fürsten zu zwingen, dem Eroberer in geschlossenen Kriegsscharen zu dienen, ist in der Weltgeschichte ohne Beispiel. Man achtete dabei nicht auf die den Sachsen angestammte Liebe zu ihrem Vaterlande und zu ihrem Fürsten. Diese zeigte sich jedoch bald zu Friedrichs Erstaunen.
Man hatte wohl auf Ausreißer gerechnet, allein daß ganze Bataillone mit Entschlossenheit und Ordnung davongehen würden, dies kam unerwartet. Die meisten zogen regelmäßig ab, mit allen militärischen Ehrenzeichen, nachdem sie ihre Befehlshaber verjagt oder erschossen hatten. Sie nahmen die Brot- und Munitionswagen, die Regimentskassen, kurz alles zum Trosse Gehörige mit und marschierten entweder nach Polen oder stießen zur französischen Armee. Der König von Preußen hatte viele sächsische Unteroffiziere zu Offizieren ernannt, um ihnen seinen Dienst angenehm zu machen. Diese Maßregel war jedoch verfehlt, denn diese Vaterlandsfreunde wurden selbst die Anführer bei der Fahnenflucht, die andern Offiziere aber, die nicht mitwollten, wurden gezwungen, sich zu entfernen. Man legte die noch übrigen als Besatzung in Städte; allein auch dieses Mittel schlug fehl. In Leipzig öffnete sich ein Teil der Garnison mit Gewalt die Tore und ging am hellen Tage davon. In mehreren anderen Städten zwangen die sächsischen Soldaten die preußischen Kommandeure, sich dem Feinde zu ergeben; ja bei manchen Gefechten gingen ganze Kompagnien Sachsen selbst auf dem Kampfplatz zu den Österreichern über und richteten sogleich ihre Waffen gegen die Preußen.
Der Feldzug war nun zu Ende. Die österreichische Armee zog sich tiefer nach Böhmen, die Preußen bezogen in Sachsen und Schlesien Winterquartiere. Friedrich blieb den Winter über in Dresden und behandelte nun das besetzte Land als eine förmlich eroberte Provinz.
Zweiter Teil: 1757
Die Zurüstungen aller wider Preußen verbündeten Mächte zum künftigen Feldzuge waren außerordentlich. Franzosen und Schweden, Deutsche aus allen Teilen des Reiches, Ungarn und Siebenbürgen, Wallonen, Kroaten, Russen, Kasaken und Kalmücken setzten sich in Bewegung. Es war ein Gedränge von Völkern, die teilweise weniger zu erobern als zu plündern und zu verwüsten kamen.
Diese Heerzüge erforderten ungeheure Summen. Da es nun fast allen Höfen an Geld fehlte, so wandten sie alle Künste an, bare Anleihen zu machen. Der König von Preußen jedoch hatte vor allen seinen Gegnern den Vorteil, diese Hilfsmittel entbehren zu können. Durch seine gefüllte Schatzkammer und sein reichhaltiges Depot vermochten die preußischen Truppen, mit allen Bedürfnissen genügend versehen, diesen Feldzug zu eröffnen.
Im Januar schrieb Friedrich an den Minister Grafen Finckenstein einen Brief, der in kurzen Worten seine Wünsche im Falle seines Todes bestimmte. »Die Angelegenheiten,« schrieb er u. a., »sollen dann ohne die geringste Änderung ihren Lauf behalten. Wenn ich das Unglück hätte, vom Feinde gefangengenommen zu werden, so verbiete ich, daß man auf meine Person die geringste Rücksicht nehme, oder daß man im allergeringsten darauf achte, was ich etwa aus der Gefangenschaft schreibe. Wenn mir ein solches Unglück begegnet, so will ich mich für den Staat opfern, und man soll alsdann meinem Bruder Gehorsam leisten, welchen ich, ebenso wie die Minister und die Generale mit ihrem Kopfe dafür verantwortlich mache, daß man für meine Befreiung weder Lösegeld, noch eine Provinz anbiete, daß man vielmehr den Krieg fortsetze und alle Vorteile benutze, ganz so, als hätte ich niemals existiert.«
Diese Gemütsruhe, die das Bewußtsein seiner Stärke bewirkte, wurde jedoch auf mannigfaltige Weise gestört. Ganz besonders durch einen Vorfall, dessen nähere Umstände nur sehr wenigen bekannt sind. Friedrich sollte vergiftet werden. Ein Kammerlakei, namens Glasau, der beim Könige in großer Gunst stand, so daß er oft in seinem Bettzimmer schlafen mußte, ward gedungen, den Monarchen aus der Welt zu schaffen. Nur wenige Personen waren in den Plan eingeweiht, und von diesen war keine Entdeckung zu besorgen. Ein Zufall aber verriet dem Könige in der Stunde der Ausführung, daß ein Anschlag wider sein Leben geplant sei. Glasau umfaßte die Füße des Monarchen und flehte um Gnade, die ihm jedoch nicht gewährt werden konnte. Friedrich ließ ihn festnehmen, in seiner Gegenwart gerichtlich verhören und sodann am nächstfolgenden Tag in Ketten nach Spandau bringen, wo er in einem Kerker in kurzer Zeit sein Leben endigte.
Inzwischen arbeiteten die Verbündeten mit großem Eifer an den gewaltigen Zurüstungen. Frankreich zeigte seinen Eifer so sehr, daß es England zu gewinnen suchte, Preußen nicht zu unterstützen; allein König Georg verwarf den Antrag. Dagegen erlangten die Künste und das Gold des französischen Gesandten in Stockholm, daß Schweden den Krieg gegen Preußen beschloß.
Der Plan zur Teilung der preußischen Staaten stand schon im voraus fest. Pommern sollte an Schweden fallen, Schlesien an Österreich, das Königreich Preußen an Rußland, das Herzogtum Magdeburg nebst Halberstadt an Sachsen, und die Besitzungen am Rhein waren für Frankreich bestimmt. Nur das Kurfürstentum Brandenburg sollte dem entthronten Könige als eine Gnade gelassen werden, wenn er sich noch zur rechten Zeit unterwürfe; wo nicht, so waren die Mächtigen entschlossen, das verheerte Land dem nächsten Erben zu überliefern.
Auf dem deutschen Reichstag in Regensburg erhoben die sächsischen Gesandten, von den Bundesgenossen unterstützt, Klage über Klage. Man bediente sich dort der ungebührlichsten Ausdrücke in Reden und Schriften, und selbst vor Schimpfwörtern scheute man sich nicht. Friedrichs Einfall in Sachsen wurde als ein in der ganzen Weltgeschichte beispielloses Unternehmen dargestellt, und das Resultat war, daß der Reichstag den Staatsdonnerkeil ergriff, um ihn auf den König von Preußen zu schleudern. Er sollte förmlich in die Reichsacht getan und dadurch aller seiner Reichsländer, Würden und Titel verlustig erklärt werden. Mit der kaiserlichen Partei stimmten die Reichsstädte und sogar neun protestantische Fürsten für diesen Antrag, darunter auch die mit Preußen verwandten Höfe Ansbach und Darmstadt.
Man wollte jetzt förmlich zur Erklärung der Reichsacht schreiten. Der kaiserliche Notarius Dr. April wurde beauftragt, sich in Begleitung von zwei Zeugen mit einer Vorladung zu dem preußischen Gesandten Baron Plotho zu begeben. Der Gesandte sollte innerhalb zweier Monate vor der Reichsversammlung erscheinen, um anzuzeigen, was er der Anklage auf die Reichsacht entgegenzusetzen habe. Plotho, der sich seiner Rechte bewußt war, zeigte die größte Verachtung gegen diese Vorladung, zwang den Überbringer, sie wieder zurückzunehmen, schob ihn selbst zur Tür hinaus und ließ ihn sodann durch seine Bedienten zum Hause hinauswerfen.
Obgleich die Reichsacht unausgesprochen blieb, wurde beschlossen, trotzdem gegen Friedrich als einen Feind des Reiches zu verfahren. Es wurde aus den mit Österreich verbündeten Staaten ein Heer aufgeboten, das unter dem furchtbaren Namen »Reichsexekutionsarmee« den Reichstagsbeschlüssen den nötigen Nachdruck geben sollte. Zu den vielen feindlichen Heeren, bei denen Friedrichs Untergang die Losung war, kam also noch ein neues (29 000 Mann stark), und schon fing man an, den nahen Zeitpunkt zu berechnen, wo der Krieg beendigt sein würde.
Es blieb Friedrich jetzt nichts übrig, als durch den wirksamsten Gebrauch seiner Waffen dem Kriegsgewitter allenthalben die Stirne zu bieten, und er schritt nun in seinen sächsischen Operationen nachdrücklicher zu Werke. Er sah jetzt ein, daß das von ihm so sehr gewünschte sächsische Bündnis für ihn offenbar nachteilig gewesen wäre, und daß der uneingeschränkte Besitz eines großen schönen Landes ihm unendlich mehr Vorteile verschaffte. Keine Provinz konnte so wie Sachsen allen seinen Operationen einen Zentralpunkt geben und ihm Rücken und Flanken decken.
Sämtliche sächsischen Gehälter und Besoldungen wurden herabgesetzt oder eingezogen, der ungeheure Vorrat von Porzellan in Dresden und Meißen wurde für preußische Rechnung als erbeutetes Eigentum verkauft. Das königliche Schloß in Dresden ließ Friedrich unberührt; die Paläste des Grafen Brühl dagegen, den er als den Urheber des Bündnisses betrachtete, das Sachsen mit seinen Feinden geschlossen hatte, ließ er verheeren.
Die Festung Königstein war auf Augusts Bitten von Friedrich während des ganzen Krieges für neutral erklärt worden. Die Österreicher aber wünschten sehr, diese Feste zu besitzen, und beschlossen daher, sie mit Einstimmung des sächsischen Kommandanten zu überrumpeln. Friedrich erfuhr von diesem Plane und erinnerte durch einen Brief sofort den Kommandanten an seine Pflicht, die ihm anvertraute und als neutral erklärte Festung nicht überfallen zu lassen, mit der Bedeutung, daß er eine Überraschung für ausgeschlossen halte. Geschähe sie dennoch, so würde er als Verräter mit Ehre und Leben dafür verantwortlich sein. Diese Erinnerung tat ihre Wirkung, und der Versuch unterblieb. Überhaupt war Friedrich sehr auf seiner Hut, und seiner Wachsamkeit entging nichts. Die Gräfin Brühl erhielt aus Polen ein Faß ungarischen Weines. Die Sache schien unbedeutend; allein da sie eine so wichtige Person betraf, deren geringste Handlung genau beobachtet wurde, meldete man sie dem Könige. Er befahl die schleunige Ablieferung des Weines und bat sich nur das Faß aus. Nun wurde in Gegenwart eines Abgeordneten der Wein im Palast abgezapft und sodann dem Könige das Faß gebracht. Es war ausgefüttert und mit vielen Briefen und Papieren ausgefüllt.
Die Reichsarmee sollte nun zusammentreten. Die bayrischen, württembergischen Soldaten und einige mehr ausgenommen, war der Rest der Armee ein Zusammenfluß undisziplinierter Scharen. In Schwaben und Franken waren Reichsstände, die nur einige Mann stellten. Auf manchen fiel allein die Lieferung eines Leutnants ohne Soldaten, der oft ein vom Pfluge weggenommener Bauerkerl war. Andere lieferten bloß einen Tambour und gaben ihm eine Trommel aus ihren alten Rüstkammern. Schweinetreiber rückten zu Querpfeifern auf, und abgelebte Karrengäule wurden bestimmt, Dragoner zu tragen. Die Reichsprälaten, die sich brüsteten, Bundesgenossen so großer Monarchen zu sein, ließen ihre Klosterknechte die Kittel ablegen und schickten sie zur Armee. Waffen, Kleidung, Bagage, kurz alles war bei diesen zusammengetriebenen Menschen verschieden, die man mit dem Namen »Soldaten« belegte, und von denen man große Dinge erwartete.
Indessen wurden von seiten der Preußen die wirksamsten Maßregeln getroffen, den Feldzug früh zu eröffnen, um den feindlichen Bundesgenossen zuvorzukommen. Die gefährlichsten und am meisten bereiten Gegner waren die Österreicher. Auf diese beschloß daher Friedrich mit vereinigten Kräften loszugehen, um womöglich einen großen Schlag auszuführen, bevor sich die Heere der andern Mächte nähern könnten. Der kaiserliche Hof nahm ein entgegengesetztes Verfahren an und wollte sich bloß auf Verteidigung beschränken, bis man, mit sämtlichen Bundesgenossen vereinigt, auf einmal den König von Preußen von allen Seiten anfallen und vernichten könnte.
Friedrich drang Ende April mit fünf Kolonnen in das Königreich Böhmen ein. Alle diese von verschiedenen Seiten anrückenden Kolonnen betraten am nämlichen Tage den böhmischen Boden, der König selber ging mit den seinen über die Moldau im Angesichte des Feindes, der seine ganze Macht beisammen hatte und jetzt den kostbaren Augenblick versäumte, Friedrichs kleines abgesondertes Heer mit überwiegendem Vorteil anzugreifen. Es herrschte eine Eifersucht bei den obersten Befehlshabern der kaiserlichen Truppen, die sich auf mancherlei Art geltend machte; denn Browne war jetzt dem Prinzen Karl von Lothringen untergeordnet, der als oberster Feldherr kommandierte. Diese Heerführer ahnten keinen feindlichen Einfall in Böhmen; sie glaubten, Friedrich würde sich in Sachsen zu verteidigen suchen.
Am 6. Mai frühmorgens waren alle preußischen Armeen, über 100 000 Mann stark, in der Gegend von Prag versammelt. Sie vereinigten sich hier bis auf zwei Kolonnen, die auf der andern Seite der Moldau blieben. Das preußische Heer, soweit es wirklich zum Treffen kam, war 64 000 und das österreichische 61 000 Mann stark. Dieses stand auf verschanzten Bergen. Die Zugänge waren zum Teil sumpfige Wiesen, abgelassene Teiche, deren Boden voller Schlamm und mit Gras bewachsen war, ferner schmale Dämme, ja Stege, die die Bewegungen sehr erschwerten. Die österreichische Infanterie stand, mit Kochen beschäftigt, ruhig in diesem festen Lager, während die Kavallerie ausgeschickt war, Futter zu holen, als Friedrich anrückte; denn man hatte, ungeachtet aller von den Vorposten eingebrachten Nachrichten, im kaiserlichen Lager seinen Anmarsch nicht glauben wollen. Prinz Karl ließ nun in größter Eile die Furagierer zurückkommen, die auch zum Teil in ihren Kitteln mit den Preußen fochten. Trotz des sehr ungünstigen Geländes rückte die preußische Infanterie mit einem bewundernswürdigen Mute vor. Sie konnte nur rottenweise über die schmalen Dämme gehen, und die, die durch Wiesen wateten, blieben bei jedem Tritt im Schlamme stecken, sanken teilweise gar bis an die Knie in Morast. Mehrere Bataillone mußten unter diesen Umständen ihre Kanonen zurücklassen. Gegen 10 Uhr eröffneten die Preußen den Angriff. Ungestüm gingen sie auf den Feind los, der sie mit einem mörderischen Artilleriefeuer empfing. Rottenweise stürzten sie zu Boden. Das Regiment Winterfeldt griff dennoch eine Batterie an und erlitt furchtbare Verluste. Der König hatte Befehl gegeben, ohne mit Musketen zu schießen unverzüglich mit gefälltem Bajonett einzudringen; allein das Kartätschenfeuer der Österreicher war so vernichtend, daß die Todesfurcht endlich der Tapferkeit ein Ziel setzte und mehrere Regimenter zurückwichen.
Indessen war die Kavallerie beider Heere auch ins Handgemenge geraten. 20 Schwadronen Kürassiere griffen die feindliche Kavallerie an, mußten aber, da diese weit überlegen war, zurückgehen; ebenso bei einem zweiten Angriff, den sie mit 20 Eskadrons Dragonern zusammen machten. Unterdessen hatte jedoch Zieten mit 45 Schwadronen Husaren und Dragonern die rechte Flanke der kaiserlichen Reitermasse umgangen, griff dort überraschend an und sprengte sie vollständig auseinander.
Winterfeldt hat sich zu Pferde vor das Schwerinsche Regiment gesetzt, unter furchtbarem Kartätschenhagel ist er auf 200 Schritt an die feindliche Front herangekommen, schon macht diese Kehrt, da sinkt er selbst von einer Musketenkugel am Halse verwundet bewußtlos vom Pferde. Die eben noch mit langen Schritten vorrückenden Soldaten stutzen, beginnen zu feuern und weichen dann langsam zurück. Nun kommt Schwerin angesprengt. Er nimmt einem Stabskapitän die Fahne aus der Hand und setzt sich mit den Worten: »Heran, meine Kinder!« an die Spitze seines Regiments, das nun nach dem Anblick des vergötterten Regimentschefs begeistert wieder vorgeht. Die Fahne soll ihnen den Weg zum Siege zeigen, und die Preußen fanden auch diesen Weg, allein der edle Wegweiser fiel, durch fünf Kartätschenkugeln zu Boden gestreckt. Die Fahne deckte ihn und verhüllte das Antlitz des sterbenden Helden. Die preußische Infanterie kämpfte nun in heißem Ringen, in dem zwei Regimenter nahezu aufgerieben wurden, stundenlang gegen die sich verzweifelt wehrenden Österreicher und trieb sie von Höhe zu Höhe in der Richtung auf Prag zurück. Die letzte Stellung der Kaiserlichen wurde um 3 Uhr nachmittags überwältigt.
Das geschlagene Heer war jetzt in zwei Armeen geteilt, von denen die schwächere sich auf die Flucht ins weite Feld begab und die andere sich nach Prag hineinwarf. Diesen Zufluchtsort wählte man, ohne die Folgen zu überlegen. Man sah jedoch die Gefahr dieser Lage schon in den ersten Stunden ein; denn noch am nämlichen Tage unternahmen die Österreicher einige schwache Versuche, sich wieder herauszuziehen, allein die Preußen hatten alle Ausgänge der Stadt besetzt und zwangen sie, wieder in die Festung zurückzukehren.
Der Verlust der Preußen an diesem Tage war 14 000 Mann an Toten und Verwundeten; 1800 waren gefangen worden. Die Österreicher zählten 13 200 Tote und Verwundete, darunter 4280 Gefangene; außerdem fielen 33 Kanonen, 11 Fahnen und Standarten, die Kriegskasse und viele Bagage den Siegern in die Hände.
Am Tage nach der Schlacht schrieb Friedrich an den Marschall Keith: »Nach den Verlusten, die wir gehabt haben, bleibt uns als einzige Tröstung, die Leute, die in Prag sind, zu Gefangenen zu machen. Und dann, glaube ich, ist der Krieg zu Ende.« Aber so blutig die Schlacht war, und so große Erwartungen auch ganz Europa jetzt hatte, so kam doch alles ganz anders. Alle Welt glaubte, daß die flüchtige österreichische Armee verfolgt und aufgerieben, die eingeschlossene aber durch Feuer und Hunger zur Übergabe gezwungen werden würde. Allein die Hoffnungen der Preußen wurden vereitelt.
Prag hatte nun innerhalb seiner Mauern ein ganzes Kriegsheer. Neben der Besatzung waren hier nahezu 50 000 Mann beisammen, worunter sich alle vornehmen Befehlshaber, auch Prinz Karl von Lothringen, befanden. Friedrich ließ die umfangreiche Festung unverzüglich berennen und alle Ausgänge mit Batterien besetzen. Noch am Abend des 6. Mai wurde die Festung aufgefordert, sich zu ergeben. Die Antwort war, man würde sich bis aufs äußerste verteidigen. Anfangs glaubte man in Wien, daß eine so gewaltige Armee wie die eingeschlossene kaiserliche die Riegel ihres Kerkers bald sprengen würde. Offenbar beherrschte dieser Gedanke auch die österreichische Heeresleitung in der ersten Zeit; denn zweimal waren Versuche angesetzt worden, mit dem gesamten eingeschlossenen Heere durchzubrechen; beide wurden aber aufgegeben, als Meldungen eintrafen, die Preußen stünden zur Abweisung in ihren Schanzen bereit. Die Besatzung mußte sich bereits in den ersten Wochen mit dem Fleische geschlachteter Kavallerie- und Artilleriepferde begnügen. Da man einen so außerordentlichen Vorfall nie vermutet hatte, so war man darauf gar nicht vorbereitet. Die Magazine in der Stadt waren ungenügend gefüllt, die Truppen litten an allem Mangel, und die 80 000 Einwohner schwebten in Gefahr, Hungers zu sterben.
Ein großer Ausfall, den die Besatzung in der Nacht des 23. Mai unternahm, scheiterte wegen mangelhafter Anordnungen ihrer Führer und an dem Widerstand der Preußen. Nachdem dann das Belagerungsgeschütz vor der Festung angekommen war, konnte die Beschießung in der Nacht zum 30. Mai beginnen. Da man den Endzweck hatte, die Magazine dieser Hauptstadt zu vernichten und die dort herrschende große Unruhe zu vermehren, so warf man Bomben und glühende Kugeln in die Stadt, die viele Häuser in Brand steckten und eine fortdauernde Feuersbrunst unterhielten. Die Preußen konnten nachts das Geschrei und Wehklagen der Einwohner deutlich hören. 12 000 wurden aus der Stadt gejagt, um die Hungersnot zu vermindern; allein die Kanonenkugeln der Belagerer trieben sie in ihr Elend wieder zurück. Nach einer dreiwöchigen Belagerung lag die ganze Neu- und Judenstadt in Asche; auch einige Proviantmagazine waren dabei in Flammen aufgegangen. Alle Straßen waren mit Wagen und Pferden bedeckt, die Kirchen lagen voller Verwundeter und Kranker, und der Tod räumte unter Menschen und Vieh wie bei der Pest auf.
Anfangs war in der österreichischen Kaiserstadt die Bestürzung allgemein gewesen, als sich dort die Kunde vom Verluste der Schlacht und ihren Folgen, der Einschließung des größten Teils der Armee, verbreitete. Aber gar bald erkannte man im Hofkriegsrate die Vorteile, die darin lagen, daß nun der größte Teil des Preußenheeres ebenfalls zum Stilliegen vor der Stadt verurteilt war und somit auf keinem anderen Kriegsschauplatze zur Verwendung kommen konnte. Dieser Zeitgewinn mußte ja den Verbündeten zugute kommen, die mit ihren Kriegsvorbereitungen noch so sehr im Rückstande waren!
Im preußischen Lager war man anfangs der Meinung gewesen, die Lebensmittel in Prag würden in Anbetracht der starken Besatzung und des Umstandes, daß die Stadt 80 000 Einwohner hatte, nur etwa zwei Wochen ausreichen. Entgegen dieser Erwartung widerstand aber die Festung, auch nachdem die Beschießung begonnen hatte, während der zweiten Juniwoche noch immer. Mehr und mehr mußte Friedrich einsehen, daß die Menge des herangeführten Geschützes nicht ausreiche. Dabei begannen die Lebensmittel, besonders die Futtervorräte, bei dem langen Stillstehen im eigenen Lager knapp zu werden. Friedrich wußte, daß die Russen, Schweden, Franzosen und Reichstruppen sich von allen Seiten seinen Staaten näherten. Jeder Tag war ihm kostbar. Noch nie im Schlachtfelde überwunden, dachte er kaum an die Möglichkeit einer Niederlage. Er ließ daher den größten Teil seines Heeres bei Prag stehen, um die Belagerung fortzusetzen, und zog mit dem andern dem Feldmarschall Daun entgegen, um so alle Hoffnungen der Belagerten auf einmal zu vernichten.
In Wien aber begann man nunmehr ernstlich an einen Entsatz der eingeschlossenen Armee zu denken, da die Vorräte dort im letzten Drittel des Juni zu Ende gehen mußten. Theresia forderte Daun auf, die hierfür nötigen Schritte sofort einzuleiten. Dieser Feldherr war mit 14 000 Mann aus Mähren gekommen und hatte etwa 16 000 Flüchtlinge sowie mehrere kleine Korps zu sich herangezogen. Jetzt lagerte er mit 54 000 Mann und etwa 60 schweren Geschützen auf den Bergen bei Kolin, wo er sich sorgfältig verschanzte.
Mitte Juni stand Friedrich, durch mehrere Truppenabteilungen verstärkt, mit 33 000 Mann und gegen 30 schweren Kanonen bei Kolin, war also bedeutend schwächer als sein Gegner. Dazu waren vor der Front des österreichischen Heeres Dörfer, Hohlwege und senkrechte Anhöhen, zum Teil sehr schwer zu ersteigen, und eine überlegene Artillerie schien vollends allen Angriffen ein Ziel zu setzen. Aber der noch niemals besiegte König schreckte vor all diesen Hindernissen keinen Augenblick zurück. Er ließ in der Frühe des 18. den östlichen Flügel des Gegners angreifen. General Hülsen mit 7 Bataillonen führte diesen Angriff mit einem Mute aus der die Feinde in Erstaunen setzte. Siebenmal wiederholten die Preußen den Angriff auf den so überaus vorteilhaft aufgestellten Feind; aber nicht Tapferkeit und Kriegskunst entschieden den Ausgang dieses denkwürdigen Tages, sondern Zufälle. Die Preußen hatten schon sehr große Vorteile erlangt: Der rechte Flügel des Feindes war geschlagen, ein Kavalleriekorps vom General Zieten hinter einen Grund zurückgedrängt, so daß es ganz von Dauns Armee getrennt war, und schon beschloß dieser ernstlich den Rückzug. Die Adjutanten flogen mit diesem Befehle von Flügel zu Flügel. Bereits führte man das Geschütz ab, als die Schlacht sich auf einmal ganz unerwartet zu Friedrichs Nachteil veränderte.
Des Königs weise Anordnungen wurden nie so schlecht befolgt wie an diesem Tage. Der rechte Flügel sollte zurückgehalten, d. h. die nach griechischem Muster gebildete schräge Schlachtordnung angewandt werden. Das geschah nicht. Generalmajor Manstein, dessen Brigade sich in der Mitte dieses zurückzuhaltenden Flügels befand, stieß nördlich des Dorfes Chozenitz auf Kroaten. Um sich ihres lästigen Feuers zu erwehren, vertrieb er sie mit seinen fünf Bataillonen, folgte ihnen aber blindlings durch das Dorf bis an den Fuß einer steilen Höhe und ward dort von der Übermacht in ein stehendes Feuergefecht verwickelt. Im ersten Treffen war durch dies eigenmächtige Verfahren Mansteins eine Lücke entstanden, die vom zweiten Treffen ausgefüllt werden mußte; infolgedessen bestand dieses nur noch aus einer Brigade von vier Bataillonen. Der linke Flügel, im ganzen 19 Bataillone stark, ging inzwischen siegreich vor und eroberte eine ganze Anzahl schweren Geschützes. Aber Daun führte frische Bataillone heran. Friedrich versuchte den Mangel an frischen Infanteriekräften durch einen Reiterangriff auszugleichen; doch dieser wurde durch einen Gegenangriff österreichischer Reiter abgewiesen. Nun setzt der König seine letzten inzwischen herangekommenen Reitergeschwader unter dem Generalmajor Krosigk, die Rochowkürassiere und Normandragoner, ein. Diese beiden äußerst braven Regimenter durchbrechen zwei Infanterietreffen, wobei das ungarische Regiment Haller, das seine Patronen verschossen hatte, zum Säbel greift, um sich der Kürassiere, die Oberst Seydlitz führt, zu erwehren. An dem hinter diesen beiden Infanterietreffen stehenden Reitertreffen bricht sich aber die Wucht der Attacke, und die erschöpften preußischen Reiter müssen weichen. Der nun völlig entblößte linke Infanterieflügel, der in stundenlangem heldenmütigen Ringen schwer gelitten hat und fast aller Offiziere beraubt ist, vermag dem jetzt erfolgenden Ansturme von 80 Schwadronen nicht mehr standzuhalten; er wird völlig zersprengt, und nur schwache Trümmer sammeln sich an der nach Kolin führenden Kaiserstraße.
Friedrich hatte sich persönlich der Gefahr aufs äußerste ausgesetzt, solange ihm noch ein Schimmer von Hoffnung blieb, das Geschick des Tages zu seinen Gunsten zu gestalten. Nun wendet er sein Pferd langsam dem rechten Flügel zu und befiehlt dem dort kommandierenden Herzog von Bevern, mit diesem den Rückzug zu decken. Er selbst reitet, nur von einer Eskadron Garde du Korps begleitet, nach Nimburg voraus. Der acht Bataillone Beverns harrt nun mit sinkender Sonne noch schwere Blutarbeit. Ganz besonders zeichnet sich hierbei das erste Bataillon Leibgarde aus. Es hat vier Bataillone und zwei Kavallerieregimenter abgewiesen. Dann verläßt es, auf allen Seiten von angreifenden Reitern umschwärmt, in stolzer Ruhe als letzte Truppe das Schlachtfeld. Diese schönen Riesen, sämtlich unter Friedrichs Leitung bei den Potsdamer Manövern groß geworden, viele noch aus dem Regimente stammend, das er als Kronprinz in Ruppin geführt, fochten, da bereits alles um sie her das Feld geräumt hatte, bis sie fielen. Sodann deckten ihre Heldengestalten, in Reihen und Gliedern gestreckt, den blutigen Kampfplatz.
Die feindlichen Anführer, denen ein preußischer Abzug vom Schlachtfelde einen ganz neuen Anblick gewährte, sahen diesem unerwarteten Schauspiele ruhig zu, so daß die Reste des Preußenheeres ungestört abmarschieren konnten; ein Rückzug, der mit viel Umsicht und Ordnung geschah. Der Verlust der Preußen betrug 14 000 Mann, 22 Fahnen und 45 Kanonen, der der Österreicher 8000 Mann.
Den sieggewohnten Preußen war dies noch nie erlebte Unglück überaus schmerzlich; es schien ihnen der Vorbote einer traurigen Zukunft zu sein. König Friedrich, der in Nimburg seine zerstreuten Truppen sammelte, saß hier auf einer Brunnenröhre tief nachdenklich, heftete unverwandt seine Blicke auf den Boden und zirkelte mit dem Stocke Figuren in den Sand. Die Zukunft zeigte ihm schreckhafte Bilder. Endlich sprang er auf und erteilte den ankommenden Truppen mit heiterer Miene seine Befehle. Er musterte mit tiefgebeugtem Herzen den kleinen Rest seiner Leibgarde. Alle Krieger dieser auserlesenen Schar waren ihm persönlich bekannt; er wußte ihre Namen, ihr Alter, ihr Vaterland, ihre Schicksale. In wenig Stunden hatte sie der Todesengel hingerafft; sie hatten wie Helden gefochten und für ihn waren sie gestorben. Dieser Gedanke preßte ihm Tränen aus.
Die Freude in Wien war unbeschreiblich. Es wurden glänzende Feste gegeben, große Geschenke ausgeteilt und Medaillen geschlagen. Alle Offiziere, die der Schlacht beigewohnt hatten, erhielten einen monatlichen Sold, die Unteroffiziere und Gemeinen 15 Kreuzer, alle Verwundeten aber einen zweimonatigen Sold. Um das Andenken dieses Tages den österreichischen Kriegern immer gegenwärtig zu halten, stiftete die Kaiserin den Maria-Theresia-Orden.
Friedrichs Lage war durch diesen einzigen Tag höchst kritisch geworden; seine glücklichen Aussichten waren auf einmal verschwunden, und sein Untergang schien nun unvermeidlich. Ja, als wenn ihn das Unglück auf alle Art verfolgen wollte, so erhielt er wenige Tage nach der Schlacht die traurige Nachricht von dem Tode seiner zärtlich geliebten Mutter, die aus Gram über die Zukunft sich seit dem Anfange des Krieges abgehärmt hatte und jetzt durch die Niederlage der Preußen den Todesstreich empfing.
Die Schlacht von Kolin entschied das Schicksal Prags und des darin eingeschlossenen Heeres, dem durch diesen Sieg gleichsam der Stein vom Grabe gewälzt wurde, so daß es wieder auferstehen konnte. Die Belagerung wurde nun sogleich aufgehoben. Während einer 40tägigen Einschließung waren 8535 Bomben, 75 039 Haubitzgranaten und 93 025 Kanonenkugeln auf die Stadt geschossen worden. Jetzt wurde der Abzug der Preußen in großer Ordnung ausgeführt.
Der König wollte bei der ersten Gelegenheit versuchen, die Scharte auszuwetzen. Sein Blick war nunmehr auf seine eigenen Provinzen gerichtet, die gedeckt werden mußten. Denn Kolin war die Losung für Franzosen, Russen, Schweden und Reichstruppen, die preußischen Staaten jetzt mit allem Eifer anzufallen. Eine starke russische Armee drang in Ostpreußen ein, die Hauptarmee der Franzosen hatte fast ganz Westfalen in Besitz genommen, ein anderes französisches Heer vereinigte sich mit den Reichsvölkern, um in Sachsen einzudringen, und die Schweden schifften über die Ostsee, um Pommern anzufallen.
Der Feldmarschall Browne war tot, und die österreichischen Heere standen jetzt unter dem Oberbefehle des Prinzen Karl, dem Daun als Berater beigegeben war. Diese Feldherren hatten, nachdem Friedrich aus Böhmen abgezogen war, wieder Kräfte gesammelt und benutzten seine Entfernung. Sie drangen in die Lausitz, und die Daunsche Armee eroberte Zittau, worin sich ein preußisches Magazin befand. In wenigen Stunden war diese zierliche, reiche Stadt ein rauchender Aschenhaufen. Friedrich rückte nun geradeswegs auf die Österreicher nördlich Zittau los; aber diese hatten sich derartig verschanzt, daß der König nach eingehender Erkundung vom Angriffe abstand. So sehr Friedrich eine Schlacht wünschte, so sorgfältig vermied sie der kaiserliche Feldherr, der selten geneigt war, sich mit den Preußen im freien Felde zu schlagen, am wenigsten jetzt, da verbündete Armeen aus allen Himmelsgegenden im Anzuge waren. Ein französisches Korps war schon bis Erfurt gekommen, ein zweites Heer rückte nach. Die Reichstruppen rückten von Süden, die Russen von Osten und die Schweden, die schon in Pommern angelangt waren, von Norden heran.
Der Anführer des französischen Heeres war der Marschall d'Estrées. Er überschritt den Rhein, verwüstete die preußischen Besitzungen dort und im Westfälischen und erhob Kriegssteuern in Hannover. Man war hier zum Widerstand nur unvollkommen vorbereitet. Der über 100 000 Mann starken französischen Macht stand ein nur 47 000 Mann starkes Heer gegenüber, das aus Hannoveranern, Hessen, Braunschweigern und einigen Bataillonen Preußen bestand und dessen Führer der unfähige Herzog von Cumberland, ein Sohn des Königs Georg, war. Dieser zog sich dauernd zurück und versäumte dabei mehrere günstige Gelegenheiten, d'Estrées zu schlagen. Endlich setzte er sich nahe der Festung Hameln bei dem Dorfe Hastenbeck fest. Hier griffen die Franzosen an, und als sie nach lebhaftem Gefechte einige Batterien wegnahmen und sich einer Anhöhe bemeisterten, verlor Cumberland Mut und Besonnenheit und verließ höchst übereilt das Schlachtfeld, – gerade als der Sieg wieder anfing, sich auf seine Seite zu neigen. Als Cumberland nachher erfuhr, wie nahe er dem Siege gewesen – zwei seiner Abteilungen hatten bedeutende Vorteile errungen – weinte er aus Verzweiflung über seine begangenen Fehler. Übrigens ist diese Schlacht auch darum höchst merkwürdig, weil d'Estrées kurz nach Cumberland ebenfalls den Rückzug anordnete, von derselben Befürchtung wie sein Gegner ausgehend, daß er umgangen sei. Sein einzigstes Verdienst war in diesem Falle, daß er den Rückzug der Verbündeten früher bemerkte als diese den seinen und nun schleunigst von neuem vorrückte, um das von jenen verlassene Schlachtfeld wieder zu besetzen. Ein gleichartiges Beispiel kennt die Kriegsgeschichte nicht. Das hannoversche Ministerium, das im Auftrage des Königs Georg das Kurfürstentum regierte, überlieferte durch einen im Kloster Zeven (nordöstlich von Bremen) abgeschlossenen schimpflichen Vertrag den Franzosen das ganze Land, und der Herzog von Cumberland hatte sich durch den fortwährenden Rückzug so in die Enge treiben lassen, daß er in diesem Vertrage – sein Heer aufzulösen versprach. Zwar verwahrte sich Cumberland ausdrücklich dagegen, daß der Vertrag als Kapitulation angesehen werde. Das änderte aber an dessen Schimpflichkeit nichts.
Bald danach vereinigte sich ein zweites französisches Heer unter Soubise, einem Günstling der Pompadour, in Thüringen mit den Reichstruppen unter dem Prinzen von Hildburghausen und zog dann ostwärts, um Sachsen zu befreien. Auf dem Wege dahin wurden Städte und Dörfer ausgeplündert, verheert und von den wehrlosen Einwohnern durch Drohungen unerschwingliche Kriegssteuern erpreßt. Die Gewalttaten der Franzosen waren so groß, daß sie fast den Greueln der Kasaken gleichkamen. Sie prügelten reiche Leute auf ausdrücklichen Befehl vornehmer Offiziere jämmerlich, um Brandschatzungen zu erpressen. Sie spielten gleichsam mit dem Leben der Menschen. Unschuldige Menschen wurden, aus unbegründetem Verdacht, ohne einen Schatten von Beweis, als Spione aufgehängt.
Aber schon Mitte August war König Friedrich mit rund 25 000 Mann nach Thüringen aufgebrochen. Dort angelangt, teilte er sein Heer in mehrere Korps, um den verschiedenen Armeen, die auf Sachsen und den Mittelpunkt seiner Staaten anrückten, Hindernisse in den Weg zu legen. So hatte er, als er bei Erfurt ankam, nur noch etwa 10 000 Mann bei sich. Um nun diese große Schwäche dem Feinde zu verbergen, ließ der König seine Truppen nicht an einer Stelle lagern, sondern in Dörfern Unterkunft beziehen und diese oft wechseln, wobei die Namen der Regimenter, um die Spione zu betrügen, jedesmal verändert wurden.
Inzwischen waren auf den Unglückstag von Kolin weitere Unglücksnachrichten gefolgt. Die Russen waren, gegen 90 000 Mann stark, in Ostpreußen eingefallen, und der greise Feldmarschall Lehwaldt war Ende August bei Groß-Jägerndorf geschlagen worden. Da die ungeheure russische Armee aber in Preußen, das sie zur Einöde gemacht hatten, keinen Unterhalt finden konnte, mußte sie bald den Rückzug antreten. Diesen Rückzug bezeichneten Feuer, Plünderung und alle nur ersinnlichen Grausamkeiten. Die Städte, Flecken und Dörfer, wohin diese höllischen Schwärme kamen, gingen in Rauch auf, und die Landstraßen waren mit Leichnamen von Menschen und Pferden bedeckt. Die zur äußersten Verzweiflung getriebenen preußischen Bauern wehrten sich und machten dadurch ihr Unglück noch größer. Lehwaldt aber konnte sich nun gegen die Schweden wenden, die ohne große Mühe aus Pommern vertrieben wurden. Dagegen waren die Österreicher in Schlesien eingefallen, ja, der General Hadik war sogar in Berlin eingedrungen und hatte dort Kriegsgelder erhoben. Das Schlimmste jedoch war die Nachricht von dem Vertrag im Kloster Zeven. Dadurch verlor Friedrich auf einmal eine Hilfsarmee, die bisher die Franzosen im Felde beschäftigt hatte; nun konnten diese ihre ganze Macht gegen ihn allein verwenden.
Friedrichs Lage war verzweifelt. In der Nähe und in der Ferne Feinde, die sich beständig mehrten. Vergebens floß das Blut seiner tapferen Krieger. Die riesenhafte Macht der Gegner wuchs beständig. So gerecht aber auch seine Besorgnis war, der Menge zu unterliegen, so war er fest entschlossen, bis zum Äußersten Widerstand zu leisten und wenigstens mit Ehren unterzugehen. Zunächst beschloß er, sich in Paris Achtung zu erzwingen. Er suchte die vereinigten Franzosen und Reichsvölker zu einer Schlacht zu bringen und rückte ihnen entgegen.
Am 15. Oktober war Friedrich in Begleitung einer größeren Reiterschar nach Gotha geritten, um das Herzogspaar zu besuchen, hatte auf dem Schlosse gespeist und war dann in Begleitung von einem Regiment Dragoner in sein Hauptquartier bei Erfurt zurückgekehrt, während Seydlitz mit den übrigen Dragonern und Husaren in und bei Gotha stehen blieb. Im Lager der Verbündeten hatten sich über die Anwesenheit des Königs in Gotha und die Stärke der ihn begleitenden Truppen die abenteuerlichsten Gerüchte verbreitet, und man beschloß eine gewaltsame Erkundung, um die Stärke des in Gotha befindlichen Feindes festzustellen. Von beiden Heeren wurden die auserlesensten Truppen, im ganzen 10 000 Mann, für das Unternehmen ausgewählt. Seydlitz räumte die Stadt sofort, als er ein so zahlreiches Aufgebot anrücken sah. Die gesamte Generalität der Verbündeten begab sich sogleich aufs Schloß zum Frühstück. Aber Seydlitz war nicht gesonnen, Gotha den Feinden ohne weiteres zu überlassen. Er hatte etwa 1900 Reiter beisammen und beschloß, mit dieser Schar dem übermütigen Feinde einen Streich zu spielen. Er stellte seine sämtlichen Schwadronen in zwei Gliedern auf, ließ einen Teil davon absitzen, so daß er von weitem für Infanterie gehalten werden konnte, und schickte einen zuverlässigen Dragoner in die Stadt, mit dem Auftrage, sich als Überläufer auszugeben und auszusagen, der König sei mit dem ganzen Heere im Anzuge.
Die Husaren sprengten zwei Tore, jagten durch die Stadt und machten gegen 100 Gefangene. Seydlitzens Schaustück, auf einer Höhe 3000 Schritt östlich der Stadt in drei Linien hintereinander aufgestellt, wirkte so verblüffend auf die frühstückende Generalität, daß diese sogar Geschütze zu erblicken glaubte und Hals über Kopf den Rückzug anordnete. »Zu Roß und Wagen eilte alles zum Tore hinaus, Eisenach zu,« berichtet ein glaubwürdiger Augenzeuge. Seydlitz besetzte Gotha nun von neuem und verließ die Stadt erst nach drei Tagen auf Befehl Friedrichs, um nach Erfurt zurückzugehen.
Unterdessen hausten die Franzosen in den Thüringer Ländern, deren Fürsten meist mit ihnen verbündet waren, wie in Feindesland. Furage, Proviant, üppige Mahlzeiten für die Soldaten und Geld für die Befehlshaber erpreßten sie mit Gewalt und drohten im Weigerungsfalle Städte und Dörfer zu verheeren. Das aber geschah ohnehin. Ganze Gegenden wurden rein ausgeplündert. Im Dorfe Branderode bei Freyburg a. U. wurde das Schloß eines Edelmannes namens Bose auf Kasakenart verwüstet. Die kostbaren Möbel, die zu schwer waren fortzubringen, wurden zerhauen, zerschnitten, die Weinfässer zerschlagen und die Briefschaften und Dokumente aus Bosheit in Stücke zerrissen. Auch die Kirchen blieben nicht verschont. Man zertrümmerte Altäre, Kirchstühle und Kanzeln.
Friedrich hatte inzwischen die Hoffnung aufgegeben, die Gegner vor die Klinge zu bekommen, ehe dessen Verstärkungen eintrafen, und weiter nach Westen durfte er ihnen nicht folgen. Er stand daher eben im Begriffe, nach Schlesien abzumarschieren, als er Meldung empfing, die Franzosen und Reichsvölker rückten vor. Nun entschloß er sich, erst doch noch mit diesen Gegnern abzurechnen.
Ende Oktober waren des Königs Streitkräfte bei Leipzig versammelt, die Verbündeten standen bei Freyburg a. U. Am 4. November unternahm Friedrich eine Erkundung; die Armee folgte, zum Angriff bereit. Aber der König fand die Stellung zu stark, um sie mit seinen 22 000 Mann angreifen zu können. Er schätzte den Gegner nach den Aussagen der Gefangenen auf 60 000 Mann. Es waren jedoch von der Reichsarmee 25 Bataillone entsendet, so daß die Gesamtstärke nur rund 41 000 Mann betrug, während Soubise bisher tausend Ausflüchte hatte, sobald die Rede vom Schlagen war, zeigte er nun plötzlich helle Kampfeslust und ging auf Hildburghausens Vorschlag, am 5. die Preußen in ihrem Lager zu umgehen und anzugreifen, eifrig ein. Wenn man ihn und seine Armee jetzt reden hörte, so waren sie voller Begierde zur Schlacht; sie hatten nur die einzige Besorgnis, daß der König ihnen entrinnen möchte. Auch warf man im französischen Lager die Frage auf, ob es einer großen Armee auch Ehre bringe, sich mit einer so kleinen zu schlagen. Dieser lächerliche Eigendünkel sollte bestraft werden.
So kam es am 5. November bei dem Dorfe Roßbach zu einer der sonderbarsten Schlachten, die jemals geliefert wurden. Während ein Teil der preußischen Armee dem preußischen Lager gegenüber stehen blieb, bemühten sich die übrigen Truppen, Franzosen und Reichsvölker, dem Könige in die linke Flanke zu kommen. Friedrich verließ sich auf die Geschwindigkeit, womit seine Truppen in Schlachtordnung gestellt werden konnten; er sah daher den Bewegungen der Feinde gelassen zu und ließ seine Linien nicht einmal ausrücken. Das preußische Lager stand unbeweglich, und da es eben Mittag war, waren die Soldaten mit ihren Mahlzeiten beschäftigt. Erst nach 2 Uhr mittags brachen die Preußen ihre Zelte ab und setzten sich in Marsch, wobei General Seydlitz mit der Kavallerie vorherzog.
Die Generale des verbündeten Heeres wähnten das kleine Preußenheer im vollen Rückzuge nach der Saale, und die an der Spitze befindliche Kavallerie glaubte sich beeilen zu müssen, wenn sie es noch einholen wollte. Seydlitz war hinter einer Hügelkette marschiert, die seine Bewegungen vollständig verdeckte. Auf dieser Hügelkette (Janushügel) hatten fünf Eskadrons Husaren seine Manöver verschleiert, und der Gegner war so siegesgewiß, daß er gar keinen Versuch machte, diesen Schleier zu durchbrechen. Als Seydlitz sich überzeugt hat, daß er sich in der Flanke der feindlichen Kavallerie befindet, bricht er gleich einem Gewittersturme auf den ahnungslosen Feind los. Die vordersten Regimenter kommen noch zu notdürftigem Aufmarsche; alles andere gerät in das bunteste Durcheinander, und wenige Minuten genügen, den Gegner vollständig zu werfen. Vergebens führt Soubise die am Ende der Marschkolonne befindliche Kavallerie persönlich heran; kaum zeigt sie sich, ist sie ebenfalls aus dem Felde geschlagen. Unterdessen rückte die vorher so ruhig gebliebene preußische Infanterie plötzlich in Schlachtordnung an und empfing die französische mit einem entsetzlichen Kanonenfeuer, auf das ein regelrechtes Musketenfeuer folgte.
Die französische Infanterie sah sich nun von ihrer Kavallerie verlassen und von den Preußen vermöge einer geschwinden Schwenkung in der rechten Flanke angegriffen. In dieser bedrängten Lage hielt sie nur ein dreimaliges Feuer von den Preußen aus, und nun warf sie sich mit Ungestüm auf ihren linken Flügel, der einen in der höchsten Unordnung befindlichen ungeheuren Menschenklumpen darstellte. In dies Gewirre stürzten einige preußische Kavallerieregimenter und wüteten entsetzlich. Ein sonderbarer Umstand gab hierzu Veranlassung. Man hatte diesen Reitern, die größtenteils in der Mark Brandenburg zuhause waren, den Tag zuvor erzählt, daß die Franzosen sich vorgesetzt hätten, ihre Winterquartiere in Brandenburg zu nehmen. Der Gedanke an einen solchen Besuch empörte sie, da sie den von diesen Gegnern in Thüringen angerichteten Schaden sahen. Als daher in der Schlacht die fliehenden Franzosen »Quartier« (Gnade!) riefen, hielten die Preußen dies Bittwort um ihr Leben für ein Gespötte und deuteten es auf die erwähnten Winterquartiere in ihrem Vaterlande. Sie schrien daher bei ihren Schwertstreichen: »Ja, wir wollen euch Quartier geben!« Viele verloren durch dies Mißverständnis ihr Leben, bis andere, mit der deutschen Sprache bekannt, endlich das Wort »Pardon!« gebrauchten, das dann auch seine Wirkung tat.
Es war 6 Uhr abends und schon ganz dunkel. Diese wohltätige Finsternis rettete den Rest der sonst dem Untergang geweihten großen Menschenschar. Die Soldaten warfen ihre Gewehre weg, um sich desto geschwinder retten zu können, die fliehende Kavallerie die Kürasse und großen Reiterstiefel, so daß man die Straße nach Erfurt wie besät fand. Viele sprangen in die Saale, um den sie verfolgenden Husaren zu entkommen. Die Schlacht, die kaum drei Stunden dauerte, kostete den Franzosen etwa 6000, dem Reichsheere 3500 Mann. Einige tausend andere fielen auf der Flucht in preußische Hände. Der Schrecken war so groß, daß sich ganze Haufen einzelner Reiter übergaben. In einem Dorfe nahmen zwei Dragoner über 100 Mann gefangen, die sich in einem Garten verborgen hatten.
Der erste Bericht des Prinzen Soubise an König Ludwig begann mit den Worten: »Ich schreibe Ew. Majestät im höchsten Grade meiner Verzweiflung: Euer Majestät Heer ist gänzlich aufgelöst; ich bin im Augenblick noch außerstande zu melden, wie viele Offiziere tot, gefangen oder sonst verloren sind.«
Die Beute der Preußen in dieser » bataille amusante« war sehr beträchtlich: 72 Kanonen, viele Fahnen, 21 Standarten und der größte Teil der französischen Bagage. Ihr Verlust betrug 30 Offiziere, 518 Mann. Ein so wohlfeiler und dabei so vollkommener Sieg gegen eine der kampfgeübtesten Armeen war in der neueren Geschichte ohne Beispiel.
Alle deutschen Völkerschaften, ohne Rücksicht auf Partei und Reichsbeschlüsse, waren von diesem Siege gegen die Franzosen, den man als einen Nationaltriumph ansah, hochbefriedigt. Fast sämtliche Nationen Europas haßten die Franzosen ihres anmaßenden Auftretens wegen, aber die Deutschen taten es ganz besonders. Die bei den Franzosen übliche laute Verachtung deutschen Namens, deutschen Verdienstes, deutschen Genies und deutscher Sprache hatten allmählich die größte Erbitterung erzeugt. Diese Volksstimmung äußerte sich allenthalben und erstickte oft alle andern Betrachtungen. Man sah ein merkwürdiges Beispiel davon selbst auf dem Schlachtfelde von Roßbach. Ein preußischer Reiter, im Begriff, einen französischen gefangen zu nehmen, erblickt in dem Augenblick, da er die Hand anlegen will, einen österreichischen Kürassier hinter sich mit dem Schwert über seinem Kopfe. »Bruder Deutscher!« ruft ihm der Preuße zu, »laß mir den Franzosen«. »Nimm ihn«, antwortete der Österreicher und eilte davon.
Von den geschlagenen französischen und Reichstruppen, von denen die Thüringer Bauern noch eine Menge Gefangene einbrachten, war auch keine Spur mehr in Sachsen und den angrenzenden Provinzen zu sehen. Sie zerstörten alle Brücken, um nicht verfolgt zu werden. Sie glaubten immer den König hinter sich zu haben, und viele Haufen machten nicht eher als am Rheine Halt.
Friedrich aber wurde durch die glücklichen Fortschritte der Österreicher nach Schlesien gerufen, wohin er mit 18 Bataillonen und 29 Schwadronen eilte. Er ließ zwar eine französische Armee an den Grenzen seiner Staaten zurück. Allein er durfte hoffen, daß dieser bald durch ein Heer Einhalt getan werde, das sich auf eine unerwartete Art wieder bildete. In England war ein neues Ministerium errichtet, an dessen Spitze Pitt stand, und diesem Minister gelang es, König Georg zu überzeugen, daß der Vertrag von Zeven sowohl eine höchst unkluge Handlung als auch ein Verrat an Englands Verbündetem sei. So kam eine neue Armee zustande, die aus Hannoveranern, Hessen, Braunschweigern und Preußen bestand. Friedrich konnte nur wenige Soldaten zu dieser Armee hergeben, allein er bestimmte auf die Bitte König Georgs einen Anführer, der ein Heer aufwog. Dies war der Herzog Ferdinand von Braunschweig, einer von den außerordentlichen Menschen, die erhabene Talente, Geistesgröße und Edelmut des Herzens in einem seltenen Grade vereinigen. Schon im Februar eröffnete er den Feldzug gegen die Franzosen, die in weiten Winterquartieren von Goslar bis Verden zerstreut lagen, und jagte sie wie das Wildbret aus den verschneiten Wäldern. In wenigen Wochen waren sie über den Rhein getrieben und ganz Norddeutschland von ihnen gesäubert. Nachdem sie sich kaum von dieser Hetze erholt hatten, griff Ferdinand sie in ihrem festen Lager bei Krefeld am 23. Juni an, und obwohl der französische General Clermont über 47 000 und Ferdinand nur über 30 500 Mann verfügte, schlug er sie doch in die Flucht. Gleich darauf erhielten sie Verstärkung, Ferdinand ging über den Rhein zurück und zwang die Franzosen, das rechte Rheinufer zu meiden. So hatte sich hier die Kriegsszene völlig verändert.
Für die grenzenlose Verachtung, die die französische Sinnes- und Handlungsart bei den deutschen Truppen hervorrief, sei hier ein Beispiel erwähnt. Ein preußischer Husar von dem gefürchteten »schwarzen Regimente« wurde von den Franzosen gefangen und ins Hauptquartier gebracht. Clermont selbst wollte ihn sprechen, denn die Gefangennahme eines preußischen Husaren war hier ein seltener Vorfall. Von den schwarzen Husaren hatte man die Sage verbreitet, daß sie bei Widersetzung nie Pardon gäben, und die Husaren bestätigten dies Gerücht, um desto leichter zu siegen. Auf Clermonts Frage, wo Ferdinand sich gelagert hätte, war die Antwort: »Da, wo ihr ihn nicht angreifen werdet«. Er wurde gefragt, wie stark die Armee seines Königs sei. Er erwiderte, sie möchten sie aufsuchen und zählen, wenn sie Mut genug dazu hätten. Clermont fühlte sich durch diese Kühnheit nicht beleidigt. Sie gefiel ihm vielmehr und veranlaßte ihn, den Husaren zu fragen, ob sein König viele solcher Soldaten hätte wie er. Der Mann antwortete: »Ich gehöre zu den schlechtesten, sonst wäre ich jetzt nicht euer Gefangener.« Eine solche Sinnesart zu finden, war den Franzosen ein Rätsel. Man entließ den Gefangenen, und Clermont schenkte ihm einen Louisdor. Der Preuße nahm ihn an; allein obgleich ausgeplündert und ohne einen Heller im Besitz, gab er in Gegenwart des Feldherrn das Goldstück einem französischen Soldaten mit der Bemerkung, daß er von den Feinden seines Volkes keine Geschenke annehme. Man trug ihm Übertritt in französische Dienste und eine Offiziersstelle an; aber er antwortete mit einem Hohnlachen, daß er ein Preuße sei.
Friedrich war indessen nach Schlesien geeilt. Der Herzog von Bevern, der diese Provinz mit 41 000 Mann zu decken beauftragt war, war nicht imstande gewesen, der ganzen Macht Österreichs zu widerstehen, die sich zur Eroberung dieses Landes vereinigt hatte. Er war den Österreichern am 22. November in der Schlacht bei Breslau unterlegen, darauf hatte die Festung Breslau kapituliert. Außerdem hatten die Kaiserlichen die Festung Schweidnitz erobert, deren Besitz ihnen die Verbindung mit Böhmen erleichterte.
Schlesien schien nun für den König von Preußen so gut wie verloren zu sein. Nie in allen preußischen Feldzügen hatte Österreichs Glück auf solcher Höhe gestanden. Die Kaiserlichen glaubten sich jetzt zu den größten Erwartungen berechtigt; sie hatten eine Schlacht gewonnen, zwei Festungen erobert, die Hauptstadt des Landes in Besitz, eine ungeheure Armee, um das Eroberte zu behaupten, und daher die besten Aussichten, den Krieg in kurzer Zeit nach Wunsch zu endigen. Der eingebrochene Winter schien allen ferneren Operationen der Preußen ein Ziel zu setzen, und man dachte schon ernstlich an Winterquartiere, als sich die ganze Szene zum Erstaunen von ganz Europa veränderte. Das Anrücken Friedrichs wurde von den Kaiserlichen als der letzte ohnmächtige Versuch eines Verzweiflungsvollen betrachtet, und seine kleine Armee von ihnen mit dem Spottnamen »Potsdamer Wachtparade« beehrt. Die preußisch gesinnten Schlesier waren ohne alle Hoffnung und die österreichisch gesinnten ohne alle Besorgnis.
Die Österreicher fühlten sich schon ganz als die Eroberer Schlesiens; schon waren von ihnen viele Verordnungen zur Regierung des Landes gegeben worden. Gefangene preußische Soldaten, die geborene Schlesier waren, hatte man frei nach Hause gehen lassen, und eine Menge Beamte hatte schon der Kaiserin Maria Theresia gehuldigt, – als die »Potsdamer Wachtparade« sich der Hauptstadt Schlesiens näherte.
Die immer zunehmende Kälte im Anfange des Dezember wies dringend auf die Notwendigkeit hin, Winterquartiere zu beziehen. Ein anderer Feldherr als der Sieger von Roßbach hätte sich bei dieser rauhen Jahreszeit in Erwartung des künftigen Feldzuges begnügt, das rechte Ufer der Oder zu behaupten, Glogau zu beschützen und Sachsen zu decken. Nicht so König Friedrich! Er war gewillt, ohne Verzug Schlesien zu befreien. Er hatte auf dem Marsche hierher die Bevernsche Armee an sich gezogen und kam nun dem Feinde, der sich bei Breslau verschanzt hatte, immer näher. Entschlossen, ihn anzugreifen, »wenn er auch auf dem Zobtenberge Weithin sichtbarer Bergkegel bei Schweidnitz. oder auf den Kirchtürmen von Breslau stehen sollte«, rief der König am 3. Dezember die Generale und Stabsoffiziere zusammen und hielt ihnen mit der ihm eigentümlichen Beredsamkeit diese jedem Hörer unvergeßlich gebliebene Ansprache: »Ihnen, meine Herren, ist bekannt, daß es dem Prinzen Karl von Lothringen gelungen ist, Schweidnitz zu erobern, den Herzog von Bevern zu schlagen und sich zum Meister von Breslau zu machen, während ich gezwungen war, den Fortschritten der Franzosen und der Reichsarmee Einhalt zu tun. Ein Teil von Schlesien, meine Hauptstadt und alle meine darin befindlich gewesenen Kriegsbedürfnisse sind dadurch verloren gegangen, und meine Widerwärtigkeiten würden aufs höchste gestiegen sein, setzte ich nicht ein unbegrenztes Vertrauen in Ihren Mut, Ihre Standhaftigkeit und Ihre Vaterlandsliebe, die Sie bei so vielen Gelegenheiten mir bewiesen haben. Ich erkenne diese dem Vaterlande und mir geleisteten Dienste mit der innigsten Rührung meines Herzens. Es ist fast keiner unter Ihnen, der sich nicht durch eine große ehrenvolle Handlung ausgezeichnet hätte, und ich schmeichle mir daher, Sie werden bei vorfallender Gelegenheit nichts an dem mangeln lassen, was der Staat von Ihrer Tapferkeit zu fordern berechtigt ist. Dieser Zeitpunkt rückt heran; ich würde glauben, nichts getan zu haben, ließe ich die Österreicher im Besitze von Schlesien. Lassen Sie es sich also gesagt sein: ich werde gegen alle Regeln der Kunst die beinahe dreimal stärkere Armee des Prinzen Karl angreifen, wo ich sie finde. Es ist hier nicht die Frage von der Anzahl der Feinde, noch von der Wichtigkeit ihres gewählten Postens; alles dieses, hoffe ich, wird die Herzhaftigkeit meiner Truppen und die richtige Befolgung meiner Dispositionen zu überwinden suchen. Ich muß diesen Schritt wagen, oder es ist alles verloren; wir müssen den Feind schlagen oder uns alle vor seinen Batterien begraben lassen. So denke ich – so werde ich handeln. Machen Sie diesen meinen Entschluß allen Offizieren der Armee bekannt; bereiten Sie den gemeinen Mann zu den Auftritten vor, die bald folgen werden, und kündigen Sie ihm an, daß ich mich berechtigt halte, unbedingten Gehorsam von ihm zu fordern. Wenn Sie übrigens bedenken, daß Sie Preußen sind, so werden Sie gewiß sich dieses Vorzuges nicht unwürdig machen; ist aber einer oder der andere unter Ihnen, der sich fürchtet, alle Gefahren mit mir zu teilen, der kann noch heute seinen Abschied erhalten, ohne von mir den geringsten Vorwurf zu leiden.«
Nach einer Pause, in der der König mit Befriedigung die begeisterten Blicke seiner zahlreichen Zuhörer wahrnahm, fuhr er mit freundlichem Lächeln fort:
»Schon im voraus hielt ich mich überzeugt, daß keiner von Ihnen mich verlassen würde; ich rechne also ganz auf Ihre treue Hilfe und auf den gewissen Sieg. Sollte ich bleiben und Sie für Ihre mir geleisteten Dienste nicht belohnen können, so muß dies das Vaterland tun. Gehen Sie nun ins Lager und wiederholen Sie Ihren Regimentern, was Sie jetzt von mir gehört haben.«
Bisher hatte Friedrich im Tone der Überzeugung gesprochen, um die Begeisterung seiner Zuhörer anzufachen. Jetzt aber, da er sich von der zwingenden Gewalt seiner Rede überzeugt hielt, sprach er wieder als König, um die Strafen anzukündigen, die er über die verhängen wollte, die ihre Pflicht zu tun versäumen würden.
»Das Regiment Kavallerie,« sagte er, »das nicht gleich, wenn es befohlen wird, sich unaufhaltsam in den Feind stürzt, lasse ich sofort nach der Schlacht absitzen und mache es zu einem Garnisonregimente. Das Bataillon Infanterie, das, es treffe worauf es wolle, nur zu stocken anfängt, verliert die Fahnen und Säbel, und ich lasse ihm die Borten von der Montierung abschneiden. Nun leben Sie wohl, meine Herren, binnen kurzem haben wir den Feind geschlagen, oder wir sehen uns nie wieder.«
Begeistert und entschlossen, ihre Kräfte und Fähigkeiten bis zum äußersten anzuspannen, kehrten die Offiziere zu ihren Truppenteilen zurück. Dort gingen bald die Worte des Königs von Munde zu Mund. Und dann ritt Friedrich selber durch das Lager und redete in der ihm eigenen Art, die ihm längst die Herzen seiner alten Krieger erobert hatte, die Leute an. Selten wohl ging ein Heer mit größerem Opfermute dem Kampfe entgegen, als diese kleine Preußenschar es tat.
Prinz Karl hatte am 2. Dezember einen Kriegsrat zusammenberufen, in dem der vorsichtige Daun und auch Graf Serbelloni dafür stimmten, Friedrich in der seither eingenommenen Stellung zu erwarten. Die Mehrheit gab ihre Stimme aber dahin ab, daß es »unter der Würde der siegreichen kaiserlichen Waffen sei, der ›Potsdamer Wachtparade‹P nicht entgegenzurücken«. Prinz Karl, dem diese Worte schmeichelten, stimmte freudig zu, und es ward beschlossen, dem Könige entgegenzumarschieren, um ihn zeitig »aus den Stellungen zu vertreiben, in denen sie sich sonst allzusehr zu befestigen vermöchte.«
Es war am 5. Dezember, als bei dem Dorfe Leuthen ein Sieg geliefert wurde, der der größte des Jahrhunderts bleiben sollte. Die Preußen waren 35 000, die Österreicher 75 000 Mann stark. Diese, voll Vertrauen auf ihre gewaltige Macht, auf ihr riesenhaftes Bündnis und auf den Besitz des schon halb eroberten Schlesien; die Preußen aber voll Zuversicht auf ihre taktischen Künste und auf ihren großen Anführer.
Die Nachricht von dem schnellen, entschlossenen Vorgehen Friedrichs überraschte die österreichischen Generale aufs äußerste. Sie bezogen sofort ein Lager am Ostabhang eines Höhenzuges zwischen den Dörfern Nippern und Leuthen. Als die Kaiserlichen in der Frühe des 5., nachdem es hell geworden war, das kleine Preußenheer zum Angriffe bereit heranrücken sahen, vermochten sie kaum ihren Sinnen zu trauen. Seit Jahren hatte sich Friedrich mit der »schrägen Schlachtordnung« beschäftigt: er glaubte, durch sie seine dem Gegner an Zahl meistens unterlegenen Armeen dennoch gewiß zum Siege zu bringen. Diese Angriffsart bestand darin, daß er den einen Flügel zurückhielt, während der andere einen Flügel des Gegners überragend anpackte, so daß sein Stoß diesen umfaßte, zertrümmerte und zuletzt seine Flanke und seinen Rücken bedrohte. Sowohl in der Prager wie in der Koliner Schlacht war dieser schräge Angriff beabsichtigt; bei Prag stieß er auf unerwartete Hindernisse im Gelände, bei Kolin vereitelten mißverstandene Befehle seine Ausführung. Bei Roßbach kam er bei dem fluchtartigen Rückzuge des Feindes nicht zur Durchführung. Erst bei Leuthen gelang er.
Der Vormarsch führte auf das Dorf Borne, somit gegen den rechten feindlichen Flügel. Als die Kolonnenspitzen bei diesem Dorfe angekommen waren, gab Friedrich den Befehl zur Linienentwicklung und täuschte dadurch den Feind. Die Folge war, daß der auf diesem Flügel kommandierende General Lucchese beim Prinzen Karl um Verstärkung bat, die dieser auch gewährte. Dann ließ der König diese Scheinbewegung plötzlich wieder einstellen und die Marschkolonnen ihre Spitzen nach Süden wenden, um den linken Flügel anzugreifen. Auch diese Bewegung wurde vom Feinde falsch gedeutet; er wähnte, der König habe seine Stellung als unangreifbar erkannt und marschiere längs der Front ab, um irgendwo ein Lager zu beziehen. Daun sagte hochmütig: »Die Leute paschen ab; lassen wir sie ziehen.« Der kriegserfahrene General Nádasdy, der auf dem linken Flügel kommandierte, erkannte rechtzeitig, daß dieser Angriff ihm gelte, und erbat nun ebenfalls vom Oberkommandierenden Unterstützung, die aber erst gewährt wurde, als es viel zu spät war.
Indessen führten die Preußen ihren Angriff mit solchem Ungestüm aus, daß alles auf dem linken Flügel zurückgeschlagen wurde. Frische Regimenter kamen den geworfenen zu Hilfe; allein kaum zeigten sie sich, so mußten sie ebenfalls zurückweichen. Ein österreichisches Regiment fiel aufs andere, die Linie wurde auseinandergesprengt, und die Unordnung war unaussprechlich. Viele tausend von den kaiserlichen Truppen konnten zu keinem Schusse kommen, sie mußten mit dem Strome fort. Der stärkste Widerstand geschah in dem Dorfe Leuthen, das mit vielen österreichischen Truppen und Artillerie besetzt war. Sie wehrten sich verzweifelt, mußten aber endlich doch weichen. So erschrecklich aber auch die Unordnung bei der geschlagenen Armee war, so versuchten dennoch die besten Truppen standzuhalten; allein die preußische Artillerie schlug sie bald in die Flucht.
Als Lucchese die unaufhaltsamen Fortschritte der preußischen Infanterie bemerkte, hatte er mit seinen etwa 80 Reitergeschwadern verdeckte Aufstellung mit Front nach Süden genommen, um den richtigen Augenblick zu erspähen, der bedrängten Infanterie zu Hilfe zu kommen. Aber er hatte versäumt, gleichzeitig in südlicher Richtung aufklären zu lassen. So kam es, daß der preußische General Driesen seine Absicht längst erkannt und sich ebenfalls mit 40 Schwadronen bereitgestellt hatte. Als nun Lucchese zur Attacke anreitet, fällt ihm Driesen völlig überraschend in die Flanke, weitere 30 Eskadrons unterstützen ihn rechtzeitig, und die österreichischen Reiter fluten zurück. In panischem Schrecken jagen die kaiserlichen Schwadronen in ihre eigene, nördlich Leuthen den letzten heldenmütigen Widerstand leistende Infanterie hinein, blasses Entsetzen in deren Reihen tragend. Nun gibt es kein Halten mehr, ganze Bataillone werfen ihre Gewehre von sich, und alles flieht unaufhaltsam dem schützenden Abschnitte des Schweidnitzer Wassers zu.
Nur die einbrechende Nacht und die guten Anstalten des Generals Nádasdy, der den Rückzug des linken Flügels deckte, rettete den Rest des Heeres vor völligem Untergange. Die Preußen machten 12 000 Gefangene und eroberten 131 Kanonen, 46 Fahnen und 9 Standarten. Von den Österreichern waren 10 000 tot oder verwundet, und 6000 Ausreißer gingen nach der Schlacht zu den Siegern über, der preußische Verlust betrug rund 6300 Mann.
Zu der Geschichte des Tages gehören einige Züge, die die Stimmung der Preußen bezeichnen. Ein kaiserlicher General stieß auf einen preußischen Grenadier, dem beide Füße abgeschossen waren und der in seinem Blute schwimmend ganz gelassen Tabak rauchte. Der erstaunte General rief ihm zu: »Kriegskamerad, wie ist es möglich, daß Ihr in Eurem schrecklichen Zustande noch ruhig Tabak rauchen könnt? Der Tod ist Euch ja nahe!« Der Grenadier nahm die Pfeife aus dem Munde und erwiderte kaltblütig: »Was ist daran gelegen? Sterbe ich doch für meinen König!« Einem anderen preußischen Grenadier wurde beim Anmarsch ein Bein abgeschossen. Er rafft sich von der Erde auf, stützt sich auf sein Gewehr wie auf eine Krücke, und so schleppt er sich zu einem Standplatz, wo die Kolonnen vorbei mußten, und ruft von hier aus mit lauter Stimme den Soldaten zu: »Brüder, fechtet wie brave Preußen! Siegt, oder sterbt für euren König!«
Friedrich war noch am späten Abend in Begleitung Zietens und eines Trupps Husaren aufgebrochen, um sich der Brücke zu versichern, die bei dem Orte Lissa über das Schweidnitzer Wasser führt, damit er am folgenden Tage ungehindert die Verfolgung fortsetzen könne. In aller Stille rückte man in Lissa ein; die Straßen waren leer, in den Häusern rings aber war Licht und viel geschäftiges Leben. Einige österreichische Soldaten brachten Strohbündel aus den Häusern. Sie wurden ergriffen und berichteten, sie hätten Befehl, das Stroh auf die Brücke zu tragen, die abgebrannt werden sollte. Indessen war man doch des preußischen Besuchs inne geworden; ein Trupp österreichischer Soldaten hatte sich still gesammelt und fing plötzlich an, stark auf die Preußen zu feuern. Diese erwiderten ungesäumt den Gruß. In demselben Augenblick kam aus allen Häusern ein starkes Feuer auf die Preußen, und wieder schossen die Grenadiere auf die Fenster, aus denen gefeuert ward. Alles schrie und kommandierte durcheinander. Friedrich aber sagte gelassen zu seiner Umgebung: »Messieurs, folgen Sie mir, ich weiß hier Bescheid!« Sogleich ritt er links über die Zugbrücke, die nach dem herrschaftlichen Schlosse von Lissa führt; seine Adjutanten folgten. Kaum war er vor dem Schloßportal angekommen, als eine Menge von hohen und niederen österreichischen Offizieren, die eben ihre Mahlzeit eingenommen hatten und nun, durch das Schießen aufgeschreckt, ihre Pferde suchten, mit Lichtern in den Händen aus den Zimmern und von den Treppen herabgestürzt kamen. Erstarrt blieben sie stehen, als Friedrich mit seinen Adjutanten ganz ruhig vom Pferde stieg und sie mit den Worten bewillkommnete: » Bon soir, Messieurs! Gewiß werden Sie mich hier nicht vermuten. Kann man hier auch noch mit unterkommen?« Sie waren die größere Zahl und hätten sich durch einen kühnen Entschluß leicht der Person des Königs bemächtigen können; aber daran dachte in der Verwirrung niemand. Die österreichischen Generale und Stabsoffiziere ergriffen die Lichter und leuchteten dem Könige die Treppe hinauf in eins der ersten Zimmer. Unterdes fanden sich auf dem Schlosse immer mehr preußische Offiziere ein. Endlich ward deren Menge so bedeutend, daß Friedrich verwundert fragte, wo sie denn alle herkämen, und jetzt erst hörte er, daß seine ganze Armee auf dem Wege nach Lissa sei.
Die unmittelbare Folge dieser Schlacht war die Belagerung von Breslau, das sich nach 14 Tagen ergab. 17 700 Mann mußten das Gewehr strecken. Außerdem waren auf der Verfolgung des Feindes viele Tausende von Gefangenen gemacht, so daß die Österreicher in dem kurzen Zeitraum von zwei Wochen an 60 000 Mann verloren und die Reste ihres kurz zuvor so stattlichen Heeres nur ein Korps Flüchtlinge darstellten, die ohne Kanonen, Fahnen und Bagage, von Mangel gedrückt und von Kälte erstarrt, über die böhmischen Gebirge nach Hause zogen. Als man sie hier sammelte, fand man nur 17 000 Mann.
Der glänzende Sieg hätte König Friedrich nicht in seinem Siegeslaufe aufgehalten, wenn nicht der so weit vorgerückte Winter seinen ferneren Unternehmungen ein Ziel gesetzt hätte. Selbst die Belagerung von Schweidnitz mußte bis zum Frühling verschoben werden. Friedrich hatte aber die Genugtuung, fast alle seine Staaten wieder von den Feinden geräumt zu sehen.
Die außerordentlichen Umwälzungen, die in dem kurzen Zeitraume dieses einen Feldzuges sich ereigneten, waren ohnegleichen. Man sah im Anfang des Jahres den König von Preußen triumphieren, die Macht der Österreicher beinahe vernichtet, ein großes Heer in einer Stadt eingeschlossen und auf dem Punkte, sich zu ergeben, die Kaiserstadt selbst nicht sicher und alle Hoffnungen Theresiens fast verloren. Auf einmal sinkt Österreichs Schale wieder. Die Kaiserlichen siegen, gewinnen Schlachten und machen Eroberungen; dagegen sieht sich Friedrich geschlagen, aus Böhmen vertrieben, von seinen Bundesgenossen verlassen, von seinen zahlreichen Feinden auf allen Seiten umringt, am Rande des Abgrundes. Aber plötzlich erhebt er sich wieder, um mehr als jemals zu triumphieren. Die Heere der Russen, der Schweden, die Reichstruppen, die Franzosen, die Österreicher werden teils verjagt, teils geschlagen, teils zugrunde gerichtet, und das schon halb eroberte, von einer ungeheuren siegreichen Armee gedeckte Schlesien wird mitten im Winter durch einen Schwertstreich wiedergewonnen.
Dritter Teil: 1758
Wenn Maria Theresia im Anfang des Dezember 1757 ganz Schlesien so gut wie erobert und den Krieg als beendigt angesehen hatte, so zertrümmerte die Schlacht bei Leuthen alle diese Hoffnungen. Neue Armeen mußten jetzt errichtet, ausgebildet und mit Kriegsgeräten versehen werden. Hierzu waren ungeheure Summen erforderlich, und zwar zu derselben Zeit, da andere Massen von Geld nach Petersburg wanderten, um die Russen zum zweitenmal nach dem Königreich Preußen zu bringen.
Die Russen waren bei Eröffnung des Feldzuges von 1758 die ersten auf der Kriegsbühne. Nachdem Friedrich Schweidnitz zurückerobert und nach vergeblicher Belagerung von Olmütz einen meisterhaften Rückzug nach Schlesien ausgeführt hatte, wandte er sich gegen sie. Ihre Vertreibung erforderte jetzt die Hauptkraft; denn General Fermor hatte bereits im Januar das Königreich Preußen besetzt und, da es ganz leer von Truppen war, es ohne Schwertstreich in Besitz genommen. Die Russen betrachteten dies Land von nun an als ihr Eigentum, das sie im Frieden zu behalten hofften, und behandelten es während des ganzen übrigen Krieges mit einer beispielwürdigen Schonung. Dann aber verließ Fermor mit seinen 60 000 Mann Preußen und nahm seinen Zug nach Pommern und der Mark, und jetzt waren diese Eroberer nicht mehr durch höhere Befehle im Zaum gehalten. Wie im vorigen Jahre bezeichneten Blut und brennende Dörfer ihren Pfad in diesen beiden unglücklichen Provinzen.
Fermors Augenmerk war auf das Innere der preußischen Staaten gerichtet. Er fing Anfang Juli an, Küstrin einzuschließen und mit Bomben und glühenden Kugeln zu beschießen. General Dohna, der von Stralsund herbeigeeilt kam, vermochte dies mit seinen geringen Kräften nicht zu verhindern, und die Geschütze des Verteidigers trugen nicht weit genug. Schon am ersten Tage brach in den überaus engen Straßen eine verheerende Feuersbrunst aus, die mit rasender Eile um sich griff. Die unglücklichen Einwohner gerieten gänzlich außer Fassung, und die Mehrzahl dachte nicht an Löschen, sondern nur an das Bergen ihrer eigenen Habe. Die ganze Stadt war bald nur noch ein rauchender Trümmerhaufen, nur die Festungswerke waren fast unversehrt. Der Kommandant lehnte daher die Aufforderung zur Übergabe ab. Zwei Tage nachher mußten aber die Verteidiger ihr Geschützfeuer einstellen, weil das der Angreifer überlegen war. Doch bereits nahte der König.
Friedrich hatte den größten Teil seiner Armee in Schlesien zurückgelassen, um diese Provinz zu decken; er nahm bloß 14 000 Mann auserlesener Truppen, zog einige andere Truppen heran und rückte in Eilmärschen seiner Kurmark zu Hilfe. Diese kleine Armee brannte vor Verlangen, sich an einem Feinde zu rächen, den sie zwar noch nie gesehen hatte, von dessen Grausamkeiten und Verwüstungen aber die rauchenden Schutthaufen beredtes Zeugnis ablegten. Kaum kannten sie ihr verödetes Vaterland mehr. In 12 Tagen machte Friedrich einen Zug von 35 deutschen Meilen bei sengender Hitze und tiefen sandigen Wegen, und so langte er am 21. August bei Küstrin an, wo er die Besatzung verstärkte und sich mit der Dohnaschen Armee vereinigte. Die Husaren brachten ihm hier 12 gefangene Kasaken, die er als die ersten, die sein Auge sah, wegen ihrer besonderen Gestalt und ihres elenden Aufzuges sehr ernsthaft betrachtete, worauf er zum Major Wedel sagte: »Sehe Er hier, mit solchem Gesindel muß ich mich herumschlagen.« Fermor hob die Belagerung von Küstrin auf, und beide Heere näherten einander. Friedrich war durch den Anblick der verwüsteten Fluren, der zahllosen Schutthaufen und der ihrer Habe beraubten umherirrenden Flüchtlinge aufs tiefste ergriffen. Er traf alle Anstalten, den Rückzug des Feindes zu hemmen und ihn nach den Morästen der Oder zu drängen und dort zu vernichten.
Die Lage Friedrichs war abermals verzweiflungsvoll und hing von dem Ausgange einer Schlacht ab. Die feindlichen Heere waren im Begriffe, sich zu vereinigen und ihn von Elbe und Oder abzuschneiden. Die Franzosen und Reichstruppen befanden sich auf dem Marsche nach Sachsen, wohin Daun mit der Hauptarmee der Österreicher auch gezogen war. Es war am 25. August, als die große Schlacht bei Zorndorf geliefert wurde. Sie fing morgens um 8 Uhr an. Die Russen waren 44 000 und die Preußen 37 000 Mann stark. Diese brachen um 3 Uhr früh aus ihrem Lager, das nördlich des russischen war, auf, umgingen dieses, das bisher die Front nach Norden gewandt hatte, in weit nach Osten ausgreifendem Bogen, um südlich Zorndorf aufzumarschieren. So waren die Russen gezwungen, ihre Front nach Süden zu wenden. Sie standen mit der Infanterie zwischen zwei tiefeingeschnittenen Gründen in einem unregelmäßigen Viereck. Ihre gesamte Reiterei mit Ausnahme der Kasaken und Husaren stand auf dem linken Flügel außerhalb des Vierecks. Zorndorf hatten sie angezündet. Friedrich beabsichtigte, den Angriff mit dem linken Flügel zu führen, der rechte Flügel sollte zurückgehalten werden. Der Angriff ward durch ein Geschützfeuer vorbereitet, das eine verheerende Wirkung hatte. Bei einem Grenadierregimente traf eine einzige Stückkugel 42 Mann, die teils getötet, teils verwundet wurden. Gegen 11 Uhr glaubte General Manteuffel, der die Avantgarde kommandierte, zum Angriffe schreiten zu können. Der Rauch des brennenden Zorndorf und der aufwirbelnde Staub verhüllten den Angreifer derart, daß ihn die Russen erst gewahr wurden, als er auf 40 Schritte herangekommen war. Nun stürzten sie ihm mit dem Bajonett entgegen, und es kam zu einem erbitterten Handgemenge. Die Absichten Friedrichs wurden hier durch das fehlerhafte Vordringen der nachfolgenden Truppen unter General Kanitz vereitelt, der, wohl auch durch den Staub und Rauch geblendet, anstatt Manteuffel zu folgen, sich während des Vormarsches immer weiter rechts gezogen hatte, so daß sein Stoß nicht auf den bereits erschütterten rechten russischen Flügel, sondern auf die noch ganz gefechtsfähige Mitte traf. Hier konnten die Bataillone Manteuffels dem gleichzeitigen Angriff russischer Reiterei und Infanterie nicht widerstehen und wichen.
Friedrich sandte nun an Seydlitz, den Führer des linken Kavallerieflügels, Befehl, die zurückweichende Infanterie von dem sie verfolgenden Gegner zu befreien. Denselben Befehl erhalten die 20 Schwadronen des Fürsten Moritz von Anhalt. Während Seydlitz aber erst einen ihn vom Feinde trennenden Grund überschreiten muß, sieht dieser kein Hindernis vor sich und greift vor jenem ein. Die russischen Reiter, durch die Attacke bereits atemlos geworden, sind diesem Ansturm nicht mehr gewachsen, sie weichen zurück. An der Infanterie aber bricht sich der wuchtige Ansturm der preußischen Dragoner. In diesem Augenblicke treffen die Seydlitzschen Schwadronen ein und zersprengen die feindlichen derartig, daß ein großer Teil davon in das Sumpfgelände gedrängt wird, und Fermor, der vom Strome der Fliehenden mitgerissen wird, entgeht mit Mühe der Gefangenschaft. Aber nachdem die Kavallerie vom Kampffelde verschwunden war, leistete die Infanterie den preußischen Reitern noch solch zähen Widerstand, daß diese nur langsam vorwärtsdringen konnten. Erst ganz allmählich wich der rechte russische Flügel zurück. Einige Bataillone davon gerieten in die Bagage; sie plünderten die Marketenderwagen und genossen viehisch den Branntwein. Vergebens schlugen die russischen Offiziere die Fässer in Stücke, die Soldaten warfen sich der Länge nach auf den Boden, um den geliebten Trank aus dem Staube zu lecken. Viele töteten ihre Offiziere, und ganze Haufen liefen wie rasend auf dem Felde umher, ohne auf das Zurufen ihrer Vorgesetzten zu achten.
Der rechte russische Flügel war zersprengt, die Mitte hatte nur wenig gelitten, der linke Flügel war unberührt. Friedrichs linker Infanterieflügel war zwar wieder gesammelt, aber doch schwer erschüttert. Auf beiden Seiten trat in den Mittagsstunden eine Gefechtspause ein.
Kurz nach 2 Uhr führte König Friedrich den rechten Infanterieflügel gegen den linken russischen vor. Die preußischen Schwadronen warfen die feindlichen Reiter zurück; aber die kaum gesammelten Bataillone des linken preußischen Flügels, die bereits furchtbare Verluste erlitten hatten und diesen Angriff unterstützen sollten, wichen abermals und flohen in Auflösung nach Süden. Hier war nun wiederum Seydlitz rechtzeitig zur Stelle. Zwar kann er die bereits eingerissene Unordnung nicht hindern, aber er greift nun mit seinen ermatteten Pferden die Mitte der feindlichen Infanteriestellung an, während gegen 4 Uhr der rechte preußische Infanterieflügel mit klingendem Spiele gegen den russischen linken vorgeht, immer wieder von Seydlitz unterstützt. So gelingt es hier etwa um 6 Uhr, die Russen nach zähestem Widerstande über einen der Gründe langsam zurückzudrängen, so daß diese am Abend die Front nach Nordwesten, die angreifenden Preußen aber solche nach Südwesten haben; beide Heere hatten also während des Kampfes noch einmal beinahe eine vollständige Drehung ausgeführt.
Jeder andere Feldherr hätte sich mit diesem Erfolge begnügt, besonders in Anbetracht der völligen Erschöpfung seiner Truppen. Nicht so Friedrich! Er wollte den Gegner vernichten. Darum befahl er einen nochmaligen Angriff; aber die Preußen waren verbraucht, auch ging die Munition allmählich zu Ende, und die Bataillone mußten wieder zurückgehen. Unterdessen war es ganz dunkel geworden, und der Kampf erlosch auf beiden Seiten infolge völliger Ermattung nach nahezu 13stündiger Dauer. Die Preußen hatten 12 800 Mann und etwa 1900 Gefangene eingebüßt, die Russen 21 600 Mann und 2500 Gefangene. 2 Fahnen und 26 Geschütze hatten die Preußen verloren, 24 Fahnen, 103 Kanonen sowie eine russische Kriegskasse mit 850 000 Rubeln erbeutet.
Der folgende Tag brachte nichts als Kanonaden. Der König wollte den Kampf förmlich erneuern; da aber seine Truppen völlig ermattet waren, so war ein Angriff unmöglich, und die Russen zogen am 27. in der Richtung auf Landsberg ab. Dunkelheit und Nebel verhinderten, daß die Preußen den Abzug rechtzeitig bemerkten.
Die Russen schrieben sich den Sieg zu; der russische General Panin war jedoch so aufrichtig zu sagen: »Wir haben zwar den Kampfplatz behauptet, allein tot, verwundet und betrunken.« Fermor sandte Kuriere mit der Siegesnachricht an alle verbündeten Höfe und Armeen. Ähnliche Spiegelfechtereien kamen in diesem Kriege häufig vor, nur bei den Preußen nicht. Friedrich ließ den Besiegten dies Vergnügen und nützte indessen den Sieg aus. Er ließ Dohna mit einem Teile der Armee den Russen gegenüberstehen und brach am 1. September nach Sachsen auf, wo seine Gegenwart höchst nötig war.
Dort hatten die Österreicher indessen die Abwesenheit des Königs aufs beste zu benutzen gesucht. Sachsen ließ schnellere Lorbeeren hoffen als das festunggesicherte Schlesien. Daun rückte deshalb, als er erst volle Sicherheit vom Abmarsche Friedrichs nach der Mark hatte, in Sachsen ein, um Dresden zu erobern, die Preußen aus dem Lande zu treiben und den König von der Elbe gänzlich abzuschneiden. Daun machte auch einen Versuch, Dresden zu erobern, mußte ihn aber wegen der Entschlossenheit des Kommandanten Grafen Schmettau aufgeben. Aber die ungeheure Überlegenheit der Österreicher und Reichstruppen in Sachsen gab den Verbündeten Anlaß zu neuen und großen Entwürfen. Der Prinz Heinrich sollte auf einmal von vorne und im Rücken angegriffen und gänzlich aufgerieben werden. Die Feldherren der verschiedenen Armeen hatten deshalb Zusammenkünfte abgehalten, und alle Anstalten waren gemacht, als das Donnerwort: Friedrich kommt! den ganzen Plan auf einmal vernichtete. Er kam und vereinigte sich mit dem Prinzen Heinrich. Sein Wunsch war eine Schlacht, um die Österreicher nach Böhmen zu treiben und um dem arg bedrohten Schlesien zu Hilfe kommen zu können. Daun aber, der eine feste Stellung eingenommen hatte, vermied sorgfältig ein Treffen und suchte den Marsch Friedrichs durch wohlpostierte Korps zu verzögern. Erst nach längerer Zeit, während der Friedrich den Österreichern die Zufuhren abzuschneiden und die Magazine zu zerstören suchte, änderte Daun seine Stellung, nahm aber wieder ein festes Lager ein. Die Preußen lagerten sich ihm gegenüber bei Hochkirch. Die Sicherheit dieses Lagers hing von der Behauptung des sogenannten Strohmberges ab. Der preußische General Retzow bekam Auftrag, den Berg zu besetzen. Retzow fand den Berg im Besitze einer Kroatenabteilung und wagte nicht anzugreifen, ehe der König anderen Tages zu seiner Unterstützung bereitstehen konnte. Mittlerweile hatte Daun den Berg mit 4 Grenadierbataillonen und schwerer Artillerie besetzen lassen. Als der König am andern Tage vor der Stellung ankam und sah, daß Retzow seinen Befehl nicht ausgeführt hatte, ward er im höchsten Grade aufgebracht, ließ den Degen des Generals abholen und bestrafte ihn mit Arrest.
Der mangelnde Besitz des Strohmberges war es nicht allein, der die von den Preußen nun eingenommene Stellung gefährlich machte, sondern noch mehr die ausgedehnten Waldungen im Süden, die auf 1000 Schritte an den rechten Flügel heranreichten. Dazu kam noch die zahlenmäßige Schwäche des Preußenheeres dem doppelt so starken Feinde gegenüber. Friedrich verschloß sich den in seiner Stellung liegenden Gefahren keinen Augenblick; aber er scheute es, angesichts des Feindes wieder zurückzugehen, weil er befürchtete, damit ein Zugeständnis seiner Schwäche zu machen. Dazu kam, daß bisher noch niemand es gewagt hatte, ihn anzugreifen, und dem behutsamen Daun traute er ein solches Unterfangen am wenigsten zu. Deshalb beschloß er, stehenzubleiben, bis die Armee mit dem notwendigsten Brotvorrate versehen sei, und dann am 14. Oktober nach Einbruch der Dunkelheit abzumarschieren. An diesem Entschlusse hielt Friedrich fest, trotzdem verschiedene Generale Einspruch erhoben, von denen Feldmarschall Keith scherzhaft seinem gekrönten Freunde gegenüber äußerte: »Wenn die Österreicher uns in diesem Lager ruhig lassen, so verdienen sie gehenkt zu werden.« Friedrich erwiderte in demselben Tone: »wir müssen hoffen, daß sie sich vor uns mehr als vor dem Galgen fürchten.«
Der kühne Gedanke, die Preußen vermittelst eines Überfalles anzugreifen, wird dem General Loudon zugeschrieben. Die Stärke des Preußenheeres betrug in der Nacht vom 13. zum 14. Oktober 40 000, die der Österreicher 78 000 Mann. In dieser Nacht verließ die kaiserliche Armee ihr Lager. Die Zelte blieben stehen, und die Wachtfeuer wurden sorgfältig unterhalten. Trotzdem waren die Preußen die Nacht hindurch wachsam, und erst gegen Morgen überließen sie sich ohne alles Bedenken dem Schlafe.
Der Tag ist noch nicht angebrochen: die Turmuhr des Dorfes Hochkirch schlägt fünf. Da erschallen von den Waldungen am rechten Flügel her einzelne Schüsse, denen nach kurzer Pause lebhaftes Gewehrfeuer folgt. Die Preußen sind schnell unter dem Gewehre, müssen aber bald trotz aller Tapferkeit den zahlreichen Gegnern weichen. Noch immer ist Friedrich der Meinung, daß er sich nur um einen Angriff leichter Truppen handle, wie sie in kleinerem Maßstabe fast täglich vorkamen; aber nach wenigen Minuten fallen die Stückkugeln einer von Loudon westlich Hochkirch aufgefahrenen Batterie sausend zu seinen Füßen nieder, und heransprengende Adjutanten melden, daß der rechte Flügel mit Übermacht angegriffen sei. Nun zeigte sich Friedrichs Heldengeist wieder in strahlendstem Lichte. Ruhig und klar gab er seine Befehle. Und die Armee führte sie mit derselben Genauigkeit aus wie sonst. Andere Truppen hätten unter solchen Umständen das Grab ihres Ruhmes gefunden; nicht so die Preußen! hier galt der Mut allein wenig, die Manneszucht alles.
Auf dem rechten Flügel hatte sich die Lage mittlerweile bedeutend verschlimmert. Wohl hatten sich einige Reiterregimenter bemüht, die weitere Entwickelung feindlicher Kolonnen aus den Waldungen aufzuhalten, wohl brachten sie den Österreichern schwere Verluste bei, auf die Dauer vermochten sie nichts auszurichten. In und um Hochkirch tobt der Infanteriekampf weiter. Die stockfinstere Nacht wird nur durch das unsichere Licht des brennenden Dorfes zeitweise erhellt, so daß man im wütenden Handgemenge die weißen Röcke und Bärenmützen der kaiserlichen Grenadiere von den blauen der preußischen mit ihren blanken Grenadiermützen unterscheiden kann. Die große Batterie von etlichen 20 Kanonen, die gleich anfangs von den Kaiserlichen genommen wurde, wird zweimal erobert und wieder genommen, neue preußische Regimenter greifen mit unübertrefflicher Tapferkeit in den Kampf ein, geführt von Seydlitz, von Zieten, vom Könige selbst. Aber immer von neuem führen auch die Kaiserlichen frische Truppen heran. Auf dem Kirchhofe wehrt sich das Bataillon des Majors Langen mehrere Stunden gegen sieben- bis achtfache Übermacht, bis die letzte Patrone verschossen ist, dann stürzt sich Langen inmitten seiner Braven heraus und fällt, von elf Wunden bedeckt, in Gefangenschaft; ein kleiner Rest gewinnt das Freie, Hochkirch ist endgültig verloren.
Nun befiehlt Friedrich den Rückzug. Es ist 9 Uhr früh. Auch der Gegner ist derartig erschöpft und durch das nächtliche Ortsgefecht in Unordnung geraten, daß er nicht folgt, sondern erst seine Verbände ordnet.
Der linke Flügel verteidigte sich und die schwere Batterie lange gegen eine sechsfache Übermacht. Zuletzt aber mußten die Bataillone, um nicht abgeschnitten zu werden, die Batterie im Stiche lassen.
Der Marsch Friedrichs ging nicht weit. Nur 3/4 Meile vom Kampfplatze, auf den sogenannten Spitzbergen hinter dem sumpfigen Albrechtsbache, lagerte er sich mit seinen Truppen. Diese Stellung war so vorteilhaft, und das Heer selbst in geschlagenem Zustande noch so furchtbar, daß Daun keinen neuen Angriff wagte.
Die Preußen verloren an diesem unglücklichen Tage 101 Kanonen, 28 Fahnen, 2 Standarten und 9000 Mann. Der österreichische Verlust belief sich auf 7600 Mann, 1 Fahne und 3 Standarten. Zu den preußischen Toten gehörte Feldmarschall Keith.
Der König hatte sich ins stärkste Feuer gewagt; ein Pferd wurde ihm unterm Leibe erschossen, und zwei Pagen stürzten tot an seiner Seite nieder. Er war in der größten Gefahr, gefangen zu werden. Schon hatten ihn die Feinde beim Dorfe Hochkirch umringt; er entkam aber durch die Tapferkeit der ihn begleitenden Husaren. Allenthalben gegenwärtig, wo der Kampf am blutigsten war, schien er sein Leben für nichts zu achten. Diese Nacht erhöhte seinen Ruhm außerordentlich, anstatt ihn zu schwächen.
Friedrich war nach Kräften bemüht, den erlittenen Verlust und dessen üble Folgen abzuschwächen. Er scherzte selbst über diesen harten Unfall wenige Stunden nachher, da er den General Goltz sah, und seinen Morgengruß mit den Worten begleitete: »Mein lieber Goltz, man hat uns nicht gut geweckt.« Der General antwortete: »Man pflegt gewöhnlich die im Schlafe zu stören, die man am Tage nicht sprechen kann.« – »Er hat recht,« erwiderte der König, »aber ich werde den Herren, die uns so geweckt haben, am hellen Tage ihre Unhöflichkeit verweisen.« – Die Artilleristen, die sich sammelten, fragte er: »Wo habt ihr eure Kanonen gelassen?« Einer nahm das Wort und sagte: »Der Teufel hat sie in der Nacht geholt.« Friedrich erwiderte: »Nun, so wollen wir sie ihm bei Tage wieder abnehmen.«
Von Daun konnte man sagen: »Du weißt zu siegen, aber deinen Sieg zu benutzen, das weißt du nicht.« Der österreichische Feldherr erwartete von Friedrich einen verzweifelten Angriff, sobald er die Nachricht erhielt, daß Neiße belagert würde, und bezog daher ein stark verschanztes Lager. Friedrich aber benutzte die Zeit, um sein Heer marschfertig zu machen, indem er gleichzeitig den Feind, der die Straße nach Schlesien besetzt hielt, durch Scheinbewegungen täuschte. Und 11 Tage nach der Schlacht waren die Preußen schon im vollen Marsche nach Schlesien, und zwar mit solchem Vorsprunge, daß Daun alle Hoffnung aufgab, es zu hindern. Sofort wurde die Belagerung von Neiße aufgehoben. Der Entsatz belagerter Festungen ist gewöhnlich die Frucht eines Sieges oder doch sonst glücklicher Begebenheiten: hier aber konnte der geschlagene, von starken Armeen umgebene und 40 Meilen entfernte Friedrich der bedrängten Festung zu Hilfe kommen! Ganz Europa erwartete die Früchte des Hochkircher Sieges; aber keine Spur davon zeigte sich. Im Gegenteil: auch die von Österreichern eingeschlossene Festung Kosel wurde befreit und Schlesien ganz von feindlichen Truppen geräumt, und der dreifache Plan der Österreicher, in der Geschwindigkeit Dresden, Leipzig und Torgau wegzunehmen, lief unglücklich ab. Da gleichzeitig die Einschließung Kolbergs durch die Russen infolge der Wachsamkeit der Preußen aufgehoben wurde, so war der im Oktober geschlagene Friedrich am Schlusse dieses Feldzuges völlig Herr der Kriegslage.
Vierter Teil: 1759
Bei Beginn des neuen Feldzuges blickte Friedrich mit schwerer Sorge in die Zukunft. Zahlreiche Schlachten waren bisher geschlagen, ohne daß sie eine Entscheidung herbeigeführt hätten. Seine Feinde machten von allen Seiten gewaltige Anstrengungen und Rüstungen, und die Kräfte seines kleinen Staates waren durch den langen Krieg aufs äußerste erschöpft. Die englischen Hilfsgelder deckten den Bedarf nicht; die Prägung minderwertiger Geldsorten von geringerer Legierung (der verrufenen Ephraimsgulden) war eine geringe und bedenkliche Aushilfe. Da sah er sich genötigt, die in seinen Händen befindlichen Länder seiner Gegner, namentlich Sachsen, Thüringen und Mecklenburg, durch harte Kriegssteuern zu belasten. Ohne Sachsen hätte Friedrich den langen Krieg nie führen können, da er sonst seine Heere nicht genügend hätte ergänzen können. Seine Gegner konnten es leichter, da sie 90 Millionen Menschen beherrschten, während die Anzahl aller seiner Untertanen kaum 5 Millionen betrug. Sachsen war für den König die ergiebigste Quelle, die ihm immerfort Geld, Proviant und Soldaten verschaffte. So z. B. mußten im Jahre 1760 Zwickau 80 000, Chemnitz 215 000, Leipzig 1 100 000 Reichstaler erlegen. Die Kontribution des Leipziger Kreisen betrug 2 000 000 Taler an Geld, 10 000 Rekruten, einige hunderttausend Scheffel Getreide, und viele tausend Pferde, nebst einer großen Menge Schlachtvieh. Dabei wurden die besten Wälder umgehauen und das Holz an unternehmende Kapitalisten verkauft.
Der Feldzug wurde, wie im vorhergehenden Jahre, von dem Herzog Ferdinand von Braunschweig eröffnet, der es auf die Befreiung Frankfurts a. M. von den Franzosen abgesehen hatte. (Er erlitt aber bei dem Dorfe Bergen, in der Nähe Frankfurts, im April eine empfindliche Niederlage und mußte sich nach Westfalen zurückziehen, wohin ihm die Franzosen folgten. Bei Minden trug er aber am 1. August einen glänzenden Sieg über die Franzosen davon, die nun schnell an den Main zurückwichen.
Die Russen bedrohten indessen die preußischen Staaten mit einem neuen Einfall. Das Oberkommando hatte an Stelle Fermors der jüngere Feldmarschall Ssaltykow übernommen. Um eine Vereinigung der Russen und Österreicher möglichst zu verhindern, sandte Friedrich jenen den General Wedel entgegen, der aber am 23. Juli bei dem Dorfe Kay, unweit Züllichaus, geschlagen wurde und sich zurückziehen mußte. Nun kam die gefürchtete Vereinigung doch zustande; Daun entsandte Loudon, der mit 19 000 Mann bei Frankfurt a. O. zur russischen Armee stieß. Alle Bemühungen Wedels waren jetzt dahin gerichtet, den Feinden den Übergang auf das linke Oderufer zu erschweren. Währenddes eilte der König selbst nach seinen brandenburgischen Staaten und langte am 7. August in der Nähe Frankfurts an. Der Feind stand jenseits der Oder bei Kunersdorf. Daher überschritt das preußische Heer in der Nacht zum 11. unterhalb Frankfurts die Oder und lagerte dann östlich des Ortes Bischofsee.
Friedrich hatte den 79 000 Mann starken Verbündeten nur 48 000 Mann entgegenzustellen; dennoch war er keinen Augenblick im Zweifel, daß er angriffsweise verfahren müsse, weil ihm nur mit einer schnellen Entscheidung gedient sein konnte. Er erkundete noch am Nachmittage des 11. das feindliche Lager. Während dieses aber die Front nach Süden hatte, glaubte der König, dem die vorliegenden Waldstücke teilweise die Aussicht versperrten, die Front sei nach Nordosten, also seinem Lager zugekehrt. Dies mußte ihm auch als das wahrscheinlichste erscheinen. Kunersdorf hatte Ssaltykow auf den Rat Loudons anzünden lassen. Das Gelände südlich und westlich des Ortes war überhaupt nicht zu sehen. Geradezu verhängnisvoll aber wurde es für Friedrich, daß er ganz falsche Auskunft über das Gelände erhielt, das er selbst nicht sehen konnte, obgleich er zwei Förster und einen Major aus Frankfurt befragte. So blieb er in völliger Unkenntnis über die Unwegsamkeit einer südlich Kunersdorf sich erstreckenden Seenkette, deren sumpfige Umgebung ein Überschreiten nur an einzelnen schmalen Stellen ermöglichte; ebenso erfuhr er nicht, daß die Hochfläche, die er anzugreifen im Begriffe stand, von mehreren schluchtartigen Einschnitten quer durchzogen wurde, deren steile Ränder einem von Osten her geführten Angriffe außerordentliche Schwierigkeiten entgegenstellen mußten. Die Förster verneinten auch die Frage, ob Loudon, den der König noch jenseits des Bruches wußte, von da unmittelbar zur Unterstützung der Russen vorgehen könne. Sie konnten allerdings nicht wissen, daß die Russen eigens für diesen Zweck einen Knüppeldamm hergestellt hatten. So mußte Friedrich annehmen, Loudon müsse durch die Dammvorstadt von Frankfurt marschieren und werde dabei durch die dort befindliche russische Bagage aufgehalten, also vermutlich zu spät kommen. Da ihm nun ein Angriff von Norden her, in den vermeintlichen Rücken des Gegners, nicht ausführbar erschien, so entschloß er sich zu einer Umgehung der feindlichen Stellung und zu einem Angriffe von Südosten.
Am 12. August, einem Sonntage, marschierte das preußische Heer um 2 Uhr früh in aller Stille ab, um den Gegner zu umgehen; diese Umgehung betrug 10-12 km auf tiefsandigen Waldwegen. Die Generale Finck und Schorlemer sollten mit 8 Bataillonen und 21 Eskadrons auf den Höhen bei Trettin von Tagesanbruch an möglichst viel Lärm machen, um den Feind irrezuführen, von 6 Uhr an diese höhen mit Infanterie und schwerer Artillerie besetzen, aber »nicht eher attackieren«, als bis die Armee zu feuern beginnen würde. Durch Husarenpatrouillen erfuhr Friedrich jetzt, daß die Seenkette südlich Kunersdorf ein Überschreiten mit aufmarschierter Infanterie nicht gestatte. Gleichzeitig erkannte er bei einem Erkundigungsritt vorteilhafte Aufstellungen für drei schwere Batterien, und diese eröffneten kurz nach 11 Uhr ihr Feuer, gleich darauf auch die Batterien Fincks von den Trettiner höhen her, so daß 60 schwere preußische Kanonen ihr Feuer gegen die Verschanzungen des auf dem linken feindlichen Flügel liegenden Mühlberges richteten, hiergegen gingen etwa eine halbe Stunde später nach und nach 9 Bataillone preußischer Grenadiere vor, erkletterten die Brustwehr der Verschanzungen und trieben den Feind mit dem Bajonett heraus. Kurz darauf überschritten Finck und Schorlemer das tiefeingeschnittene Hünerfließ, das sie von der Stellung des linken feindlichen Flügels trennte, und vereinigten ihre Truppen mit den 9 Grenadier-Bataillonen. So gelang es den vereinten Kräften der 17 Bataillone auch, eine zweite Höhe zu nehmen. Ssaltykow hatte erkannt, daß Friedrich seine Stellung vom linken Flügel her aufrollen wollte. Er befahl eine Frontveränderung nach Osten, bei der der rechte Flügel sich an den bastionsartig vorspringenden großen Spitzberg anlehnen sollte.
Etwa um 2 Uhr stand somit die Schlacht für die Preußen so günstig wie möglich. Es war mit verhältnismäßig geringen Kräften gelungen, den Feind aus starker Stellung zu vertreiben und ihn zu zwingen, seine Front zu verändern, so daß er von seiner Übermacht nur beschränkten Gebrauch machen konnte; außerdem waren gegen 70 Kanonen erobert. König Friedrich glaubte bereits so sicher an einen Sieg, daß er um diese Zeit einen reitenden Boten nach Berlin abfertigte, um die Kunde von einer bei Frankfurt gewonnenen Schlacht dorthin zu bringen. Aber wie die preußische Infanterie nun einen tiefen Grund überschreitet, schlägt ihr ein solch vernichtender Kartätschenhagel entgegen, daß der Angriff ins Stocken gerät. Sie muß sich zu hinhaltendem Gefecht entschließen.
Hingegen gelingt es der Brigade Knobloch, Kunersdorf und die östlich liegenden Schanzen zu erobern; die dort stehenden Österreicher werden mit beträchtlichen Verlusten zurückgeworfen. Aber Loudon führt 12 frische Bataillone und Geschütze vor; diesem Ansturm ist die brave Brigade nicht mehr gewachsen. Der König bemerkt noch rechtzeitig die Gefahr; er rafft alles zusammen, was er noch an Infanterie hat. Drei Stunden lang ringen hier die Preußen um den Sieg; sechs Generale brechen hier nacheinander verwundet zusammen; endlich, der meisten Führer beraubt, geraten die stark gelichteten Bataillone in Auflösung und wenden sich zum Rückzuge.
Friedrich erkennt vom Mühlberge aus, daß der Infanterieangriff keine Fortschritte mehr macht. Soll die Schlacht noch gewonnen werden, so kann dies nur durch Kavallerie geschehen. Die Erinnerung an Zorndorf erwacht in seinen Sinnen: dieselben Reiter unter demselben Führer stehen bereit! Er schickt an Seydlitz den Befehl zu attackieren. Dieser hat lange auf dem äußersten linken Flügel gestanden und das Gelände als höchst ungünstig für seine Waffe erkannt. Er weigert sich dem den Befehl überbringenden Adjutanten gegenüber, diesen auszuführen, und reitet selbst zum Könige. Dort wird ihm durch eine Kartätschenkugel der Degengriff in die Hand hineingetrieben, und er muß den Kampfplatz verlassen. General Platen übernimmt an seiner Stelle die Führung der Attacke. Die Regimenter, die vereinzelt durch die Engen zwischen den Seen aufmarschieren, finden jenseits keine Deckung; einzeln müssen sie anreiten, stoßen auf Wolfsgruben und andere Hindernisse vor den Schanzen, geraten ins Strichfeuer der Artillerie, erleiden schwere Verluste und vermögen daher nichts auszurichten. Sie müssen durch die See-Engen zurück. Aber 1000 tote und verwundete Reiter bleiben auf dem Platze.
Aus dem rechten Flügel führt Prinz Eugen von Württemberg seine Dragoner den steilen Mühlberg hinan. Als er sich nach ihnen umwendet, ist er allein mit seinem Stabe; die Dragoner haben kehrtgemacht. In diesem Augenblicke wird der Prinz verwundet, und nur die Schnelligkeit seines vortrefflichen Pferdes bewahrt ihn vor Gefangenschaft. General Puttkamer führt sein Husarenregiment vor. Auch dieser Angriff scheitert; Puttkamer selbst fällt. Nun führt Loudon seine Reiter gegen die Infanterie Fincks. Diese, seit den Morgenstunden im Gefechte, hat nicht mehr die Widerstandskraft, den neuen Stoß auszuhalten, sie wird in den sumpfigen Elsbusch hineingetrieben, wo viele jämmerlich umkommen.
Friedrich hat sich längst in die vorderste Linie seiner Infanterie begeben. Er hat die Fahne eines Regiments ergriffen und sucht durch den Ruf: »Wer ein braver Soldat ist, der folge mir!« die Mannschaften nochmals vorwärts zu bringen. Zwei Pferde werden ihm unterm Leibe erschossen. Der Adjutant springt von dem seinigen ab, um es dem Könige anzubieten. Eine Musketenkugel ist an einem goldenen Etui, das dieser in der Brusttasche getragen hat, abgeprallt. Vergebens bestürmt ihn seine Umgebung, sich dem rasenden Kugelregen zu entziehen; er hat nur die eine Antwort: »Wir müssen hier alles versuchen, um die Bataille zu gewinnen, und ich muß hier wie jeder andere meine Schuldigkeit tun.« Aber auch dieses Beispiel ist vergebens; die Leute sind 15 Stunden auf den Beinen, durch Hitze, Sonnenbrand und Durst zum Tode erschöpft. Der König wendet sich wieder den Mühlbergen zu. Hier leistet alles, was noch fähig ist, den letzten Widerstand. Aber von Kunersdorf her nahen nochmals frische feindliche Kräfte, die auch diese letzten Anstrengungen vergeblich machen. Nun hört jede Gefechtsleitung auf; die über das Hünerfließ führenden Brücken sind bald gänzlich verstopft, die allenthalben nachdrängenden österreichischen Reiter erbeuten fast sämtliche Geschütze.
Der König verläßt als einer der letzten den Mühlberg, wie in Betäubung versunken, starren Blickes. Hinter ihm kommen Kasaken angesprengt, »Prittwitz, ich bin verloren!«, ruft er dem Rittmeister von den Zietenhusaren zu, der die Stabswache kommandiert. »Nein, Eure Majestät, das soll nicht geschehen, so lange noch Atem in uns ist«, antwortet dieser und macht wiederholt gegen die an Zahl weit überlegenen Feinde so entschieden Front, daß sie sich nicht herantrauen.
Eine bei Erettin (auf dem dortigen Spitzberge) wieder Front machende Batterie genügte, die Verfolgung zum Stehen zu bringen; Ssaltykow war trotz eifrigen Zuredens Loudons nicht zu bewegen, alles, was noch Atem hatte, einzusetzen. So gelang es, schon auf dem rechten Oderufer die Truppen notdürftig zu sammeln. »Es hätte,« sagte Friedrich später, »nur von den Feinden abgehangen, dem Kriege eine Ende zu machen; sie brauchten uns nur den Gnadenstoß zu geben.«
Der König verbrachte die Nacht im Fährhause zu Ötscher, bewacht von Prittwitz und seinen Husaren. Er war in den ersten Stunden völlig gebrochen. In diesem Zustande schrieb er an den Minister Grafen Finckenstein: »Mein Unglück ist, daß ich noch am Leben bin. von einem Heere von 48 000 Mann habe ich keine 3000 mehr. In dem Augenblicke, da ich dieses schreibe, flieht alles, und ich bin nicht mehr Herr meiner Leute. Man wird in Berlin wohl daran tun, an seine Sicherheit zu denken. Es ist ein grausamer Schlag, ich werde ihn nicht überleben; die Folgen der Niederlage werden schlimmer sein als die Niederlage selbst. Ich habe keine Hilfsmittel mehr, und, um nicht zu lügen, ich glaube alles verloren. Ich werde den Untergang meines Vaterlandes nicht überleben. Adieu für immer!«
Die Verluste der Preußen betrugen 18 000 Mann, davon 6000 tot, 26 Fahnen, 2 Standarten, 192 Geschütze. Die Verbündeten hatten 17 000 Mann verloren. Als Ssaltykow seinen Sieg an die Zarin meldete, setzte er die Worte bei: »Eure Majestät werden sich über die großen Verluste nicht wundern. Sie wissen, daß der König von Preußen seine Niederlagen allemal teuer verkauft, wenn ich noch einen solchen Sieg erfechte, so werde ich mit einem Stabe in der Hand allein die Nachricht nach Petersburg bringen müssen.«
Von den vermuteten Folgen traf keine einzige ein. Daun machte Ssaltykow bittere Vorwürfe, daß er seinen Sieg in keiner Weise ausnütze. Der russische Feldherr antwortete darauf: »Ich habe zwei Schlachten gewonnen und warte jetzt nur noch, um weitere Bewegungen zu machen, auf die Nachricht zweier Siege von Ihnen; denn es ist nicht billig, daß die Truppen meiner Kaiserin ganz allein handeln sollen.« Diese Antwort Ssaltykows war die Folge der Erbitterung, die bei allen russischen Generalen gegen die Österreicher herrschte, besonders gegen Daun, wegen der Unentschlossenheit und zu weit getriebenen Bedenklichkeit. Die russischen Feldherren taten daher wohl genau so viel, als sie tun mußten, um nicht verantwortlich zu werden, aber nicht mehr. Nie wünschten sie ernstlich eine Vereinigung mit den österreichischen Truppen, die Daun wünschte, weil sie durch diese in ihren Unternehmungen eingeschränkt und wegen des Unterhalts der Armee in noch größere Schwierigkeiten als bisher gesetzt wurden.
(Das gefangene Fincksche Korps wird in den großen Garten bei Dresden abgeführt.)
So verschlimmerten die feindlichen Siege die Lage des Königs nicht sonderlich; auch hatte er sein Heer infolge des Eintreffens versprengter und durch heranziehen der Kleistschen Truppen aus Pommern bereits wieder auf 33 000 Mann gebracht. Obwohl aber die Russen aus ihrem Siege fast gar keine Vorteile zogen, so entspann sich doch daraus für den König eine Reihe von Unglücksfällen, wie er sie in keinem seiner Kriege so gehäuft erlebt hatte. Die Feinde hatten nämlich seine Entfernung von Sachsen und Schlesien mittlerweile gut benutzt. Schlesien wurde zwar durch Fouqués Geschick behauptet; aber um so schlimmer stand es in Sachsen. Leipzig, Torgau und Wittenberg mußten kapitulieren, und sogar Dresden ging nach langem Widerstande verloren. Jene drei kamen bald wieder in preußischen Besitz. Um auch das wichtige Dresden zurückzugewinnen, wollte Friedrich seine Truppen vereinigen und dieserhalb die Daunsche Armee, die im Südosten Sachsens stand, zum Rückzuge nach Böhmen nötigen. Der General Finck sollte ihm bei Maxen in den Rücken fallen, während er selbst das abziehende Heer Dauns in ein verlustreiches Nachhutgefecht zu verwickeln gedachte. Es gelang aber Daun, den General Finck von der Verbindung mit dem Könige abzuschneiden und ihn so vollständig einzukreisen, daß er mit seinem ganzen Korps, etwa 12 000 Mann stark, die Waffen strecken mußte, – das erste Mal, daß preußischen Truppen eine solche Schmach widerfuhr. Die Feinde aber höhnten über den »Finckenfang«. Diesem Unglück folgte gleich darauf ein anderes: General Dierecke wurde mit 1400 Preußen gefangen genommen, als er zum Heere des Königs stoßen wollte.
Der sonst so behutsame Daun wurde durch diese Vorteile angespornt, sich der so sehr geschwächten Armee Friedrichs zu nähern, in der Meinung, daß sie dann zurückgehen würde und Sachsen preisgeben müßte. Er fand sie aber in Bereitschaft, ihn zu empfangen, und zog sich daher selbst wie ein Besiegter in ein festes Lager hinter dem Plauenschen Grunde zurück. Derartige Fehler der Feinde waren für Friedrich immer die besten Hilfsquellen. Er, der fast die Hälfte seiner Armee verloren und jetzt wenig mehr als 20 000 Mann beisammen hatte, die er allerdings bald durch 12 000 Mann aus Ferdinands Armee verstärkte, behauptete, mit Ausnahme des kleinen Bezirkes um Dresden, ganz Sachsen.
So konnte Friedrich am Schlusse dieses unglücklichen Feldzuges wahrlich noch sein Glück preisen. Waren auch das Königreich Preußen und andere Provinzen seiner Staaten in feindlichen Händen, so hatte er doch Schlesien und Sachsen im Besitze. Dazu behauptete Ferdinand von Braunschweig nach der Schlacht von Minden alle Provinzen und Orte wie vor Anfang des Krieges.
Fünfter Teil: 1760
Mit großen Hoffnungen eröffneten die Verbündeten den neuen Feldzug. Sie stellten gegen 300 000 Mann ins Feld, denen gegenüber Friedrich nur 90 000 Mann aufbringen konnte. Ihr Plan war, den König von Preußen zu zwingen, entweder Sachsen oder Schlesien preiszugeben. Friedrich übernahm es selbst, mit 40 000 Mann Sachsen gegen Daun zu verteidigen, seinen Bruder Heinrich entsandte er mit 35 000 Mann, um die Russen zu beobachten, der General Fouqué sollte mit 15 000 Mann Schlesien gegen Loudon schützen. Der Feldzug wurde erst spät, aber sogleich mit einer Niederlage für Friedrich eröffnet. Fouqué rückte, angetrieben durch energischen Befehl Friedrichs, in ein befestigtes Lager bei Landshut, das er kurz vorher verlassen hatte, weil er Breslau bedroht glaubte. Aber in der Nacht zum 23. Juni wurde er von dem doppelt so starken Heere Loudons angegriffen und trotz tapferster Gegenwehr gezwungen, eine Höhe nach der andern zu räumen. Als schließlich die Preußen sich durchzuschlagen versuchten, fiel Fouqué mit rund 8200 Mann in Gefangenschaft. Nur etwa 1700 Mann konnten sich nach Breslau durchschlagen.
Die wichtigste Folge des Treffens von Landshut war der Verlust der Festung Glatz. Friedrich hatte, um Sachsen vom Feinde zu befreien, Dresden eingeschossen, als er die Nachricht empfing, daß Glatz von den Österreichern eingenommen sei. Anfangs war er darüber nicht wenig bestürzt; als er seine Fassung wiedergewonnen hatte, äußerte er: »Mag es doch sein! Wenn Friede wird, werden sie uns Glatz wohl wiedergeben, wir müssen nach Schlesien gehen, damit wir nicht alles verlieren.«
Da der allzeit tätige Loudon Miene machte, Breslau zu belagern, brach Friedrich die mißlungene Unternehmung auf Dresden ab und eilte auf die Hauptstadt Schlesiens los. Daun zog neben ihm her und sorgte dafür, diesen Marsch den Preußen so beschwerlich wie möglich zu machen. Seine leichten Truppen mußten alle Brücken verbrennen und alle Wege durch Verhacke unbrauchbar machen. Friedrich überwand jedoch diese Hindernisse und setzte seinen Zug fort.
Loudon war nicht ohne Besorgnis, durch herbeieilende preußische Truppen an seinem Vorhaben gehindert zu werden, das er ohne Beihilfe der Russen auszuführen wünschte. Darum war möglichste Geschwindigkeit erforderlich. Aber er verfügte weder über Belagerungsgeschütze noch über genügende Munition für seine Feldgeschütze; auch gestatteten die mit Wasser angefüllten Festungsgräben keinen Sturm. Also blieb ihm nur übrig, den Kommandanten aufzufordern, sich zu ergeben, und er hoffte um so mehr auf Erfolg, als er der geringen Besatzung von 4000 Mann 56 Bataillone und 55 Schwadronen gegenüberstellen konnte. Und er bediente sich dabei folgender Begründung: »Breslau sei eine Handelsstadt und keine Festung; es wäre daher wider Kriegsgebrauch, sie gegen so große Übermacht zu verteidigen. Der König sei jenseits der Elbe und der Prinz Heinrich unweit der Warthe. Die Russen würden in zwei Tagen mit 75 000 Mann erscheinen; er glaube, daß die Stadt lieber Österreicher als Russen aufnehmen würde. Er wollte der Besatzung die Bedingungen der Kapitulation überlassen; würde aber die Übergabe verweigert, so solle die Stadt aus 45 Mörsern in Brand geschossen werden.« Der Kommandant, General Tauentzien, antwortete kurz: »Breslau sei eine Festung, und er würde den Feind auf den Wällen erwarten, wenn auch die Häuser in Asche verwandelt werden sollten.« Loudon wiederholte seine Aufforderung und verstärkte seine Drohungen; – vergebens. Und als Loudon mit der Beschießung begann, ließ Tauentzien sie prompt erwidern.
Tauentzien und seine Offiziere waren fest entschlossen, falls kein Entsatz käme, die Festung bis zum äußersten zu verteidigen und nötigenfalls fechtend zu sterben. Glücklicherweise kam es nicht zu dieser verzweifelten Szene; denn der Prinz Heinrich nahte in Eilmärschen, und nun war Loudon selbst gezwungen, den General Ssaltykow, der 9 Meilen von Breslau stand, zu bitten, seinen Marsch zu beschleunigen. Zuvor aber machte er einen letzten Versuch, den Kommandanten zur Übergabe zu bewegen. Der kaiserliche Oberst Rouvroy bemühte sich, die Lage nochmals möglichst hoffnungslos für die Verteidiger darzustellen. Der König sei weit entfernt, Prinz Heinrich werde durch die Russen festgehalten, und eine starke russische Armee sei im Anmarsche. Er bewilligte in Loudons Auftrag nochmals freien Abzug mit allen kriegerischen Ehren, so daß Tauentzien und seine Besatzung vor der Welt und ihrem Kriegsherrn vollständig gerechtfertigt dastünden. Tauentzien antwortete: »Ich habe keinen Begriff von der Ehre eines Kommandanten, der eine Festung übergibt, ehe Bresche geschossen ist. Unerlaubt ist's, die Belagerung einer Stadt mit dem Ruin ihrer Einwohner anzufangen. Der Brand hat meine Gesinnungen nicht geändert, vielmehr befestigt.« »Wenn das ist«, erwiderte Rouvroy, »so werden wir gleich förmlich die Laufgräben eröffnen.« »Dies habe ich schon längst erwartet«, versetzte der Kommandant, und nun schieden sie voneinander.
Mit dieser Drohung hatte das ganze Unternehmen sein Ende erreicht, denn am folgenden Tage hob Loudon die Belagerung auf.
Heinrichs schleunige Ankunft rettete nicht allein Breslau, sondern ganz Schlesien; denn die russische Hauptarmee befand sich auch schon im Mittelpunkte dieser Provinz, und der Plan ihres Heerführers war, sich mit den Österreichern zu vereinigen. Er hatte auf die gewisse Eroberung von Breslau und auf das hier befindliche große Magazin zur Verpflegung seiner Truppen gerechnet. Da diese Erwartungen aber durch die klugen Bewegungen des Prinzen Heinrich vereitelt wurden, so wagte Ssaltykow nicht, über die Oder zu gehen.
Die Russen waren mit den behutsamen Bewegungen der Österreicher gar nicht zufrieden. Sie glaubten, weil man den Marsch des Königs nach Schlesien nicht gehindert habe, würden die Österreicher ihm jetzt auch nicht verwehren, sich mit dem Prinzen Heinrich zu vereinigen und sodann mit seiner ganzen Macht auf sie zu werfen. Ssaltykow erklärte daher den Österreichern ausdrücklich, daß er, sobald man den König über die Oder heranziehen ließe, sich nach Polen zurückziehen würde.
Am 13. August erschien Loudon im Aufträge Dauns im russischen Hauptquartier mit der Versicherung, daß dieser jetzt ernstlich gewillt sei, die Preußen mit allen Kräften anzugreifen. hierauf sandte Ssaltykow den General Tschernyschew mit 24 000 Mann über die Oder, um die Verbindung mit den Österreichern herzustellen.
Hierdurch war nun Daun verpflichtet, eine Schlacht zu wagen, um den König aufzuhalten. Am 15. August sollte das preußische Lager bei Liegnitz angegriffen werden. Man wollte Friedrich mit Tagesanbruch an vier Orten zugleich anfallen und dadurch ein Seitenstück zu Hochkirch liefern. So sehr war man im österreichischen Lager von dem glücklichen Erfolge im voraus überzeugt, daß die Soldaten sagten: der Sack wäre nun aufgemacht, worin man den König von Preußen und seine ganze Armee auffangen würde. Der König erhielt zufällig erst am Abend vor der Ausführung von diesem Vorhaben Nachricht; auch erfuhr er die Prahlerei. Er erzählte sie selbst bei der Tafel und fügte hinzu: »Die Österreicher haben nicht ganz unrecht; aber ich denke, in den Sack ein Loch zu machen, das sie Mühe haben werden auszubessern.«
Bei Anbruch der Nacht zum 15. verließ der König mit der Armee das bisherige Lager, dessen Wachtfeuer jedoch durch Bauern unterhalten wurden, und Husarenpatrouillen führten alle Viertelstunden das nächtliche Lagergeschrei aus. Ähnliche Maßregeln wurden auch im Lager der Österreicher getroffen, um ihren Aufbruch zu verbergen. Friedrich zog sich auf die Anhöhen bei Liegnitz und stellte sein Heer dort in Schlachtordnung auf. Es war eine wundervolle Sommernacht. Niemand schlief. Die Soldaten hatten sich mit ihrem Gewehr im Arme gelagert, und da sie nicht singen durften, unterhielten sie sich mit Erzählen. Der König hatte sich auf dem linken Flügel an einem Wachtfeuer niedergelegt. Da kommt plötzlich gegen 3 Uhr ein Offizier angesprengt unter dem Rufe: »Wo ist der König?« Dieser richtet sich auf mit der Frage: »Was ist?« »Majestät, der Feind ist da!« und als der König ungläubig den Kopf schüttelt: »Ihro Majestät, hol mich der Teufel, der Feind ist da; ich bin selbst auf seine Infanterie gestoßen. Er hat schon alle meine Vorposten zurückgeworfen und ist kaum 400 Schritte von hier entfernt.«
Es war Loudon, der sich der Verabredung mit Daun gemäß von Osten her nahte, während Daun und Lacy von Süden und Westen her anzugreifen versprochen hatten. Friedrich steigt rasch zu Pferde und befiehlt dem General Schenckendorff, mit seiner Brigade und einer Batterie den Rehberg zu besetzen. Loudon beabsichtigte, zuerst die Bagage des preußischen Heeres wegzunehmen. Um diesen Handstreich auszuführen, beging er den verhängnisvollen Fehler, ohne jede Sicherung zu marschieren, selbstverständlich immer unter der Voraussetzung, den König stünde noch in seinem alten Lager. So kam es, daß die von ihm persönlich geführte Kolonne in das Kartätschenfeuer der Batterie Schenckendorffs ahnungslos hineinrannte und den grausamen Irrtum mit schweren Verlusten bezahlen mußte. Friedrich hatte seinen linken Flügel zur Abweisung des Angriffes bestimmt, während der rechte unter Zieten gegen die feindliche Hauptarmee in südlicher Richtung weiter beobachten sollte.
Loudon, der auf die Unterstützung seines Oberfeldherrn vertraute, nahm den Kampf an und überließ den Ausgang seinen tapferen Truppen und seinem Glücke. Aber seine Kavallerie und seine Infanterie wurden nach hartnäckigem Kampfe zurückgeschlagen. Seine Hoffnung auf Hilfe war vergebens; denn Daun erfuhr erst spät den Angriff des Königs, weil seine nur eine halbe Meile entfernte Armee wegen eines widrigen Windes nichts von dem Geschützfeuer hören konnte. Zudem wußte er bei seiner Ankunft in dem verlassenen preußischen Lager gar nicht, wo die Armee, die man so gut wie geschlagen glaubte, hingekommen war. Als er sich aber endlich dem Kampfplatze näherte, vermochte er die Preußen wegen des Geländes nicht anders als mit großem Nachteil anzugreifen. (Er machte einige Versuche, vorzudringen, allein sie mißglückten. Lacy war mit seinem Korps westlich um Liegnitz herummarschiert, war aber, als er die Preußen bereit fand, wieder umgekehrt. Loudon, der alles getan und sich persönlich der größten Gefahr ausgesetzt hatte, zog sich nun zurück und überließ dem Könige das Schlachtfeld mit einem Verluste von 10 000 Mann, darunter 5000 Gefangenen, 23 Fahnen und 74 Kanonen. Der preußische Verlust betrug 3500 Mann.
Heller Sonnenschein lachte über dem blutigen Walplatze und beschien die Leichen und Sterbenden, aber auch einen tiefergreifenden Auftritt. Das Regiment Anhalt-Bernburg hatte bei der Belagerung von Dresden einmal, als die Belagerten einen Ausfall machten, nicht lange genug in den Laufgräben ausgehalten und war der Übermacht gewichen. Der König hatte es bestraft mit dem Verluste der Seitengewehre für Unteroffiziere und Mannschaften, und die Offiziere mußten die Huttressen ablegen. Das Regiment war durch diese Strafe aufs tiefste gebeugt und ging bei Liegnitz mit dem festen Vorsatz in die Schlacht, die verlorene Ehre wiederzuerkämpfen. Dem Könige war es nicht entgangen, daß das Regiment zweimal mit unvergleichlicher Tapferkeit sich erfolgreich feindlicher Reiterei mit dem Bajonett entgegenwarf. Er ritt nach vollendeter Blutarbeit an das Regiment heran, dankte ihm mit bewegten Worten und versprach die baldige Wiederverleihung der kürzlich entzogenen Abzeichen. Ein Flügelmann und alter Veteran, der schon unter dem alten Dessauer gedient hatte, trat vor und sprach: »Ich danke Euer Majestät im Namen meiner Kameraden, daß Sie uns wieder unser Recht zukommen lassen. Euer Majestät sind nun doch wieder unser gnädiger König?« »Ja, Kinder,« war Friedrichs Antwort, »und alles soll vergessen sein.« Noch am nämlichen Tage erhielt das Regiment die entzogenen Ehrenzeichen wieder.
Die Preußen hatten bei Liegnitz einen wichtigen Sieg erfochten, der die Vereinigung der Russen und Österreicher hinderte und alle ihre Entwürfe auf die schlesischen Festungen vereitelte.
Loudon verließ das Schlachtfeld voll Grolls über die vermeintliche Wortbrüchigkeit Dauns. Dieselbe Stimmung herrschte im ganzen Heere, und in Wien bemächtigte sich der Bevölkerung eine ungeheure Erbitterung über Daun, die sich in allerlei Spottgedichten und -zeichnungen Luft machte.
Durch den Sieg war zwar dem Könige der Weg nach Breslau geöffnet; aber die Gegner, 20 000 Russen und 15 000 Österreicher, zogen nun auf Berlin los. An eine Verteidigung Berlins dieser Übermacht gegenüber war nicht zu denken, und so kapitulierte die Stadt gegen eine Kontribution von 1 800 000 Taler. Dabei wurde bestimmt, daß das Eigentum der Einwohner nicht angetastet werden sollte. Trotzdem wurde alles königliche Eigentum teils zerstört, teils weggeführt. Auch fast 300 Häuser wurden erbrochen und ausgeleert. Bei diesem Geschäfte übertrafen die Österreicher bei weitem die Russen. Nicht zufrieden mit Essen und Trinken, erpreßten sie von den Einwohnern Geld, Kleinodien, Kleidungsstücke, kurz alles, was mit den Händen fortgeschleppt werden konnte. Daß der Stadt nicht noch Schlimmeres wiederfuhr, und daß die Kontribution bezahlt werden konnte, war das Verdienst eines uneigennützigen Berliner Kaufmanns, namens Gotzkowsky, der nach der Schlacht bei Zorndorf viele gefangene russische Offiziere unterstützt und sich dadurch eine Menge Freunde in der russischen Armee erworben hatte.
Von allen königlichen Schlössern blieben nur Sanssouci sowie das Schloß in Potsdam unangetastet. Hier kommandierte der österreichische General Esterhazy, der bei dieser Unternehmung allein Österreichs Ehre rettete und sich durch Edelmut und Wahrung einer vortrefflichen Mannszucht hervortat.
Die Österreicher und Russen träumten schon von Winterquartieren in Brandenburg, denn sie betrachteten den Krieg als beendigt. Von beiden Nationen waren große Armeen im Mittelpunkte von Friedrichs Staaten, und von hier aus wurden alle Provinzen überschwemmt. Die Schweden rückten vor, die Reichstruppen waren in Sachsen, Loudon stand in Schlesien, und Daun war mit einer großen Übermacht dem Könige beständig zur Seite.
Dieser eingebildete Triumph währte aber nur einige Tage. Friedrich rauschte wie eine Flut aus Schlesien her, und nun veränderten sich auf einmal alle Szenen. Das Wort: »Der König kommt!« war wie ein elektrischer Schlag, der alles aufs schleunigste in Bewegung setzte. Die Österreicher und Russen verließen eiligst Berlin, erstere zogen nach Sachsen, um zur Daunschen Armee zu stoßen, letztere gingen geschwind über die Oder.
Inzwischen war Sachsen völlig in die Hände der Feinde geraten. Nachdem auch Daun aus Schlesien herbeigekommen war, war fast die ganze Macht Österreichs in diesem Lande versammelt, und Daun war fest entschlossen, Sachsen jetzt zu behaupten. Friedrich konnte ebensowenig auf Sachsen verzichten, und so war er zu einer Entscheidungsschlacht noch in diesem Jahre gezwungen. Der allzeit behutsame Daun bezog aber ein festes Lager bei Torgau und zog alle zerstreuten Korps an sich. Da der König nun alle Hoffnung verlor, den Gegner freiwillig zu einer Schlacht zu vermögen, so faßte er den kühnen Entschluß, ungeachtet aller Hindernisse das Lager der Österreicher zu stürmen. Dies war das einzige, was ihm übrig blieb, aber auch das Schwerste. Es mußte geschehen und sehr bald geschehen!
Der 3. November war der denkwürdige Tag, wo Menschenblut wie Wasser floß, wo der gänzliche Untergang beider so oft mit Lorbeeren gekrönten Heere auf dem Spiele stand, bis der Sieg nach langem Kampfe endlich mitten in der nächtlichen Finsternis von den Preußen errungen ward.
Der König marschierte durch die Dommitzscher Heide. Nach seinem Plane sollten beide Flügel der Österreicher zu gleicher Zeit angegriffen und auf ihren Mittelpunkt geworfen werden. Daher teilte der König sein 44 000 Mann starkes Heer, um zwei voneinander abgesonderte Angriffe zu machen. Der General Zieten wurde abgeschickt, um die unweit Torgau liegenden Anhöhen von Süptitz anzugreifen. Schlug der König den Feind mit der anderen Hälfte, so war die österreichische Hauptarmee ohne Rettung verloren, weil sie die Elbe im Rücken hatte.
Zur Erlangung dieses großen Zieles aber waren noch außerordentliche Hindernisse zu überwinden. Daun stand mit 52 000 Mann und 280 Geschützen in einer höchst vorteilhaften Stellung; Lacys Korps auf seinem linken Flügel stieß an die Elbe, der rechte war durch Anhöhen gedeckt, mit großen Batterien versehen und hatte vor der Front Waldungen, Gräben, Teiche, Verhacke und Moräste. Der Angriff auf Lacy sollte die erste Unternehmung der Zietenschen Armee sein. Diese Trennung des preußischen Heeres aber, die dem Feinde ein Geheimnis bleiben sollte, geschah erst während des Marsches. Zieten stieß bereits bei der Roten Furtbrücke auf Kroaten und erfuhr bei diesem Anlasse durch Gefangene, daß der linke Flügel Lacys sich bedeutend weiter nach Osten ausdehne, als der König annahm. Er war infolgedessen ebenfalls mehr nach Osten ausgebogen und gegenüber dem Lacyschen Korps am Waldrande aufmarschiert, seinen rechten Flügel an den Großen Teich südlich Torgau lehnend. Sobald dieser Aufmarsch beendet war, hatte sich eine lebhafte Kanonade zwischen Zietens und Lacys Artillerie entsponnen. Dieses Geschützfeuer vernahm Friedrich, als die beiden ersten Grenadierbrigaden eben aus dem Walde herausgetreten waren. Er mußte annehmen, daß Zieten bereits im heftigen Kampfe stehe, und es ging auf 3 Uhr. Der kurze Novembertag mußte sich in wenigen Stunden neigen. Darum befahl er, daß die beiden Brigaden sofort angriffen, ohne den Vormarsch der übrigen Kolonnen abzuwarten.
Daun empfing die Preußen mit einem heftigen Kartätschenfeuer; aus mehr als 100 Feuerschlünden sprühte unaufhörlich Tod und Verderben. Selbst der König brach wiederholt in die Worte aus: »Welch schreckliche Kanonade! Haben Sie je eine ähnliche gehört?« Das ansteigende Gelände vermehrte noch die Schwierigkeit des Angriffes. Die Wirkung des Artilleriefeuers war über alle Vorstellung furchtbar. In einer halben Stunde lagen von den 4000 preußischen Grenadieren, die den Verhau überstiegen und mit einem erstaunlichen Mut den Angriff gemacht hatten, etwa zwei Drittel tot oder verwundet auf der Walstatt.
Mittlerweile waren die Hauptkolonnen am Waldrande eingetroffen, und noch ehe sie den Feind zu sehen bekamen, fiel ein Geschoßhagel mit Baumästen untermischt auf sie herab. Die voll Kampfbegier anrückenden Preußen erblickten eine Walstatt voller Toter und scheußlich verstümmelter Körper. Trotz dieses Anblicks und trotz aller Schwierigkeiten unternahm die Infanterie mit dem Mute und der Ordnung, wodurch sich die Preußen auf dem Schlachtfelde von jeher auszeichneten, einen neuen Angriff gegen die durch die Niederlage der Grenadiere ermutigten Österreicher. Diese weichen zurück, aber ihre Kartätschen räumen furchtbar unter den Preußen auf. Trotzdem geht es immer von neuem vorwärts, Anhöhen werden erstiegen und gehen wieder verloren.
Nun aber ist endlich auch die preußische Kavallerie zur Stelle, die den weitesten Weg zu machen hatte und bisher immer noch nicht die Infanterie unterstützen konnte. Unter den Augen des Königs werfen sich die ersten Regimenter – Kürassiere und Dragoner – auf die österreichische Infanterie, 6 Regimenter niederreitend; des Feindes ganze Linie ist in Gefahr; aber nun stürzen von allen Seiten die österreichischen Reiter herbei, und die Preußen müssen weichen. Ein neuer, von Friedrich selbst geführter Angriff ist ebenso erfolglos. Die Nacht bricht an, und die Kräfte der preußischen Infanterie scheinen völlig erschöpft. Daun glaubte des Sieges schon ganz sicher zu sein und fertigte die Kuriere mit dieser Nachricht nach Wien ab, die unter dem Jubel der Bevölkerung in der Kaiserstadt ihren Einzug hielten und einen vollständigen Sieg verkündigten.
Der König hatte sich dem Feuer rücksichtslos ausgesetzt; zwei Flügeladjutanten und zwei Pagen waren an seiner Seite verwundet. Da trifft ihn eine matte Kartätschenkugel vor die Brust, und er sinkt lautlos vom Pferde. Der Flügeladjutant, der neben ihm reitet, fängt ihn auf. Friedrich wird in den Wald getragen, dort öffnet der Offizier seine Kleider. Es zeigte sich keine ernsthafte Verletzung, die Kugel war durch den pelzgefütterten Mantel, durch Überrock, Leibrock und Weste gedrungen und hatte so ihre Kraft eingebüßt; nur die Heftigkeit des Schlages hatte den König für einige Augenblicke des Atems beraubt. Mit den Worten: »Es ist nichts,« stieg er wieder zu Pferde.
Die preußische Infanterie war noch nicht so verbraucht, wie es auf der österreichischen Seite scheinen mochte. Der Major Lestwitz und andere Stabsoffiziere bemühten sich, die Trümmer der mehrfach abgewiesenen Bataillone zu einem neuen Angriff zu sammeln. Friedrich billigte diesen Versuch mit warmen Worten und äußerte voller Siegeszuversicht, es werde wohl Daun am andern Morgen nichts übrig bleiben als der Rückzug, da Zieten ja in seinem Rücken stehe. Diesem sandte er Befehl, sich näher an ihn heranzuziehen.
Zieten war mit den Seinen bis gegen 4 Uhr dem Korps Lacy in heftiger Kanonade gegenübergestanden. Gespannt beobachtete er, ob er bei den Kaiserlichen eine rückgängige Bewegung wahrnehme, um alsdann unverzüglich vorzugehen. Aber mit unverminderter Heftigkeit schallte das Geschütz- und Kleingewehrfeuer von den Höhen herab, ja, dieses schien sich mehr und mehr zu entfernen, offenbar kein gutes Zeichen! Es schien höchste Zeit einzugreifen, sollte die Schlacht nicht für den König endgültig verloren gehen.
Der General Tettenborn erhält Befehl, das Dorf Süptitz anzugreifen. Die Truppen dringen in den südlichen Teil ein, der Gegner steckt diese Hälfte in Brand und zieht sich in die nördliche zurück. Nun erhält General Saldern Befehl, die Weinberge nordwestlich Süptitz anzugreifen, um Tettenborn im Kampfe um das Dorf zu unterstützen. Der Angriff gelingt trotz großer Verluste, allein der Gegner erhält Verstärkung, und Saldern muß die Höhen wieder räumen. Beim Zurückgehen erhält er die Meldung eines Offiziers, daß zwischen zwei Teichen hindurch ein mit Gestrüpp völlig verwachsener Damm auf die Höhe führe. Kurz entschlossen läßt Saldern seine Truppen über diesen Damm gehen, und bald darauf stehen zwei geschlossene preußische Brigaden auf der Höhe den überraschten Österreichern in der Flanke. Mittlerweile ist es völlig finster geworden. Indem Zieten weitere Truppen heranführt, lösen sich auf beiden Seiten die Verbände mehr und mehr auf, und allmählich entsteht ein wirres Durcheinander von Freund und Feind. Einzelne Haufen sehen sich plötzlich zwischen einer Übermacht von Gegnern und müssen sich gefangen geben. Ein kaiserlicher General reitet an eine Truppe heran, die er für seine eigene hält und sich zu ordnen bemüht. Aber es sind Preußen, die ihn am Dialekt erkennen und gefangen nehmen. Ähnlich geht es andern, auch preußischen, Offizieren. Da schlagen plötzlich preußische Trommeln in der Flanke den wohlbekannten Sturmmarsch. Es ist General Hülsen mit vier frischen Bataillonen, den letzten auf dem Schlachtfelde eingetroffenen, und Lestwitz hat sich mit den von ihm gesammelten angeschlossen. Die Vereinigung beider Flügel ist nun bei völliger Dunkelheit doch noch geglückt!
Lacy versuchte zwar noch einmal, die Höhen zurückzuerobern, aber die Preußen behaupteten sie standhaft. Die Trümmer des kaiserlichen Heeres strebten zum Teil schon während der Nacht den Schiffbrücken zu. Die Preußen nahmen mehrere größere und kleinere Trupps Kaiserlicher gefangen, die in der Finsternis den Weg verfehlt hatten und umherirrten.
Auf der Walstatt aber lagen nach völlig beendigtem Kampfe vielfach Gruppen beider Heere vermischt untereinander. Die Herbstnacht war empfindlich kalt. Der Regen hatte den Boden ganz morastig gemacht, und, gequält durch Hunger, Durst, Müdigkeit und Kälte, lagen an zahllosen Feuern Preußen und Österreicher nebeneinander, nicht wie Sieger und Besiegte, sondern beide Teile bewaffnet und frei. Das große Bedürfnis nach Wärme hatte sie zufällig vereinigt, und da niemand wußte, wie das Schlachtenlos ausgefallen, so waren beide Teile übereingekommen, sich nach Tagesanbruch der Macht, die das Feld behauptet hätte, gefangenzugeben.
König Friedrich hatte auf seinem Standpunkte ausgeharrt, bis er die Meldung von der Einnahme der Süptitzer Höhen erhielt; dann wandte er sich nach dem Dorfe Elsnig. Dort fand er alle Bauernhäuser, Hütten, Ställe und Scheunen voller Verwundeter vor. Friedrich ließ sich, um sie nicht zu stören, die Kirche des Dorfes öffnen, dort ein Feuer anzünden und eine Streu herrichten. Zunächst schrieb er, auf der untersten Stufe des Altars sitzend und die oberste als Tisch benutzend, beim flackernden Lichte zweier Kirchenkerzen die Siegesbotschaft an den Minister Finckenstein, die aber noch keine Einzelheiten meldete. Der König mußte sich mit dem Gedanken vertraut machen, Daun, falls dieser nicht freiwillig über die Elbe gehen würde, am kommenden Morgen nochmals anzugreifen, und befahl, daß in diesem Falle die Infanterie sofort mit dem Bajonett vorgehen solle. Kaum aber fing die aufgehende Sonne an, das Totenfeld zu beleuchten, so wurde Friedrich gewahr, daß hier keine Österreicher mehr zu bekämpfen seien. Er sah sich im Besitze des ganzen Schlachtfeldes; der Sieg war völlig entschieden und Sachsen behauptet.
Die Österreicher waren über die Elbe gegangen und zogen längs dieses Flusses auf Dresden los. Zieten verfolgte sie auf diesem Rückzuge unablässig und machte noch viele hundert Gefangene. Beide Heere waren durch diese blutige Schlacht außerordentlich geschwächt worden. Die Österreicher beklagten einen Verlust von 16 000 Mann, fast ein Drittel ihres Bestandes, darunter 7000 Gefangene, 30 Feldzeichen, 40 Kanonen. Zwei Generale tot, Daun und vier andere verwundet. Aber die Preußen hatten den Sieg noch teurer erkauft: Mehr als ein volles Drittel fehlte, fast 17 000 Mann.
Die Folgen dieses Sieges waren überaus wichtig. Ganz Sachsen, Dresden ausgenommen, war nun wieder in den Händen der Preußen und ihre Winterquartiere gesichert. Friedrich war imstande, Truppen nach Schlesien, nach der Mark und nach Pommern zu schicken, um die Feinde aus diesen Provinzen zu vertreiben.
Alle österreichischen Kriegspläne waren auf dem durchaus irrigen Grundsatz aufgebaut, nicht alle Heereskräfte in Sachsen, sondern so viel als möglich davon für die Eroberung von Schlesien zu verwenden. Die Erfahrung lehrte jedoch, daß Schlesien nur in Sachsen erobert werden konnte. Hier richtete Friedrich sich stets wieder auf. Hier war es, wo er nach der großen Niederlage bei Kolin die nötigen Kräfte sammelte, um bei Roßbach und Leuthen zu siegen. Hier war es, wo er in der Geschwindigkeit allen üblen Folgen der Schlacht bei Hochkirch vorbeugte und die Feinde wie Überwundene vor sich hertrieb. Die Tage von Kay und Kunersdorf verloren ihr Schreckliches, sobald Friedrich das von den Feinden in Besitz genommene Sachsen wiedererobert hatte. Hier war es, wo die Gefangennahme eines großen Korps bei Maxen ganz ohne Folgen blieb und nicht einmal eine Veränderung in der preußischen Stellung bewirkte. Das unglückliche Treffen bei Landshut, der Verlust von Glatz, die aufgehobene Belagerung von Dresden und die mit so viel Zerstörung verbundene Einnahme von Berlin wurden ihm hier minder fühlbar. Nach der Schlacht bei Torgau aber zeigte er sich so furchtbar als jemals.
Sechster Teil: 1761
Daun hatte den seiner Kaiserin gemeldeten Sieg von Torgau widerrufen müssen und ihr dazu erklärt, die österreichischen Heerführer würden einen so furchtbaren Gegner wie den König von Preußen niemals bezwingen. Für Maria Theresia wurde damit der Tag von Torgau zu einer bitteren Enttäuschung; denn sie hatte sich ihrem Ziele, nicht allein Schlesien zurückzuerobern, sondern Friedrich auf den Rang eines bedeutungslosen Fürsten herabzudrücken, näher als je geglaubt. Trotzdem war die Hoffnung, Schlesien endlich doch noch zu erobern, in der österreichischen Kaiserstadt jetzt nach einem fünfjährigen, fruchtlosen Kriege noch gar nicht geschwunden, und nach längeren Verhandlungen kam man mit Rußland überein, gemeinsam vorzugehen. Das russische Hauptheer, 70 000 Mann stark, unter Buturlin, sollte auf Breslau rücken und sich mit Loudon vereinigen. Friedrich war in diesen Plan längst eingeweiht und entschlossen, die Verteidigung Schlesiens selbst zu übernehmen und dem Prinzen Heinrich die Sachsens gegen Daun anzuvertrauen. So sehr der König entschlossen war, eine Schlacht mit den vereinten Heeren zu vermeiden, da diese ihm um mehr als das Doppelte überlegen waren, so sehr ersehnte er eine Entscheidung gegen den herbeiziehenden Loudon allein; denn wenn er diesen schlug, so war der Abzug Buturlins sicher. Aber Loudon wich jeder Schlacht aus; andererseits aber wußte der König durch geschickte Märsche die Vereinigung lange zu verhindern, und als sie endlich durch meisterhafte Bewegungen Loudons dennoch erfolgte, bezog Friedrich mit seinen 55 000 Mann der feindlichen Übermacht von 13 000 Mann gegenüber ein festes Lager bei Bunzelwitz. Die von Natur schon äußerst günstige Lage dieses Ortes wurde vom ersten Tage an durch Anlage von Verschanzungen verbessert; denn der König mußte mit einem Angriff des übermächtigen Gegners rechnen. Durch tiefe Gräben, Palisaden, Sturmpfähle, Wolfsgruben, Verhaue, verschanzte Hügel, stark befestigte Dörfer, Batterien und verborgene Minen wurde das Lager künstlich allmählich in eine vollkommene Festung umgewandelt, die den Feinden unübersteigbare Hindernisse zum Angriff bot.
Trotzdem machte Friedrich sich die düstersten Vorstellungen von der Zukunft. Oft suchte er nachts Zieten auf. Der suchte den König dann zu trösten, es werde alles noch ein gutes Ende nehmen. Friedrich, der zu solcher Hoffnung gar keinen Grund sah, fragte darauf einst spöttisch, ob er sich etwa einen neuen Alliierten (Verbündeten) verschafft habe. »Nein,« antwortete Zieten, »nur den alten da oben, und der verläßt uns nicht.« »Ach,« seufzte der König, »der tut keine Wunder mehr.« »Deren braucht's nicht,« versetzte Zieten, »er streitet dennoch für uns und läßt uns nicht sinken.«
Die Gegner ließen die Zeit ungenützt verstreichen. Buturlin und Loudon konnten sich lange nicht über den Plan zum Angriff einigen, und schließlich erklärte Buturlin, nachdem er wiederholte Erkundungen des preußischen Lagers vorgenommen hatte, daß er mit seiner Armee nichts wagen, sondern nur ein Korps zur Unterstützung senden wolle. Der Hauptgrund für diese Weigerung, an einem gemeinschaftlichen Unternehmen teilzunehmen, war die Eifersucht der russischen Generale auf Loudon als die eigentlichen Sieger von Kunersdorf.
Je länger sich der Angriff verzögerte, um so zuversichtlicher sah Friedrich ihm entgegen. Von Tag zu Tag wuchs seine Überzeugung, daß die Gegner einen etwa unternommenen Sturm mit ungeheuren Opfern bezahlen würden und daß er in einem solchen Falle sicher siegen würde. Zudem konnte er erwarten, daß der Hunger im feindlichen Lager zu irgend einer Änderung zwang. Während er selbst durch die reichlich gefüllten Magazine in Schweidnitz beruhigt war, war bei den Gegnern Mangel an den nötigsten Bedürfnissen, um so mehr, als die Russen von Anfang an auf die österreichischen Magazine angewiesen waren, die aber einen solchen Verbrauch auf die Dauer nicht vertragen konnten.
Den Russen wurde die Not zuerst unerträglich. Buturlin beschloß deshalb, sich nun von den Kaiserlichen zu trennen. Er ließ Tschernyschew mit 20 000 Russen zurück und ging mit dem größeren Teile der Armee nach Polen. Die Nachricht von dem Abzug der Russen erregte großen Jubel im preußischen Lager, und da Loudon keine Lust zum Schlagen zeigte, obgleich er in Verbindung mit dem russischen Korps noch fast doppelt so stark als das königliche war, verließ Friedrich 14 Tage später Bunzelwitz und marschierte ab, um Loudon durch Scheinbewegungen aus seinem Lager zu entfernen und nach Böhmen treiben zu können. Loudon aber hatte eine Überrumpelung der wichtigen Festung Schweidnitz in Aussicht genommen, und da die Vorbereitungen sehr geheimnisvoll getroffen wurden, ferner ein gefangener österreichischer Offizier, der des Kommandanten Gunst genoß, jeden wichtigen Umstand an Loudon zu melden wußte, so gelang das Vorhaben: nach dreistündigem Sturm war die Festung mit Tagesanbruch des 1. Oktober erobert und ohne vorhergegangene Belagerung, ohne Kapitulation in die Hände der Gegner gelangt.
Damit hatte Loudon den kaiserlichen Waffen wieder einen höchst wichtigen Vorteil errungen; denn durch die Eroberung von Schweidnitz waren die Österreicher zum ersten Male in Stand gesetzt, Winterquartiere in Schlesien zu nehmen. Friedrichs Heer war aufs äußerste bestürzt; alle Früchte eines ehrenvollen, höchst mühseligen Feldzuges hatte man auf einmal eingebüßt. Hierzu kamen schlimme Nachrichten aus Pommern: Kolberg, das sich mit Beihilfe der tapferen Bürgerschaft lange heldenmütig verteidigt hatte, wurde von den Schweden und Russen genommen. Letztere nahmen nun zum ersten Male Winterquartiere in Pommern und in der Neumark. Der Verlust von Kolberg und von Schweidnitz in einem so kurzen Zeitraume war daher für den König ein unabsehbar großes Unglück. Alle Kriegsbedürfnisse und Lebensmittel für die russischen Heere in Pommern konnten jetzt leicht zur See herbeigeschafft werden, und die Österreicher hatten nun in Schlesien festen Fuß. Die Feinde aus diesen Provinzen zu vertreiben, erforderte viel Blut, viel Zeit, viel Geld und noch mehr Glück. Es waren hierzu stärkere Kräfte als jemals vonnöten. Wo aber sollten diese gefunden werden? Die erfahrensten Feldherren waren mit der Blüte des Adels gefallen; die Mehrzahl der alten Soldaten lag auf den Schlachtfeldern begraben. Die Einkünfte aus dem größten Teile der preußischen Staaten blieben entweder ganz aus oder waren doch sehr geschwächt, und die noch übrigen sächsischen Quellen fingen auch an zu versiegen. Dresden und ein Teil von Sachsen waren in österreichischen Händen, und das preußische Heer verlor mehr und mehr das Übergewicht über die feindlichen Armeen. Der König befand sich also in einer übleren Lage, als je am Schlusse eines Feldzuges, obgleich er diesmal keine Schlacht verloren hatte. Immerhin waren seine Truppen vom besten Mute beseelt, und der ungeschwächte Eifer, die rastlose Tätigkeit so manches seiner Generale machten diesen Zustand erträglich. Man hatte viel gewonnen, da man die Hoffnung noch nicht verloren hatte.
Siebenter Teil: 1762
Während die Preußen in Sachsen ihre Winterquartiere nahmen, suchten sich die Österreicher und Russen in den eroberten preußischen Ländern immer mehr festzusetzen. Weil sie nun zum ersten Male auf preußischem Gebiete überwinterten, betrachteten die Kaiserlichen Schlesien als ihr unbestreitbares Eigentum. Und so sehr war man jetzt in Wien überzeugt, den Frieden leicht und vorteilhaft zu erhalten, daß sogar im Dezember 1761 in der österreichischen Armee eine bedeutende Verminderung vorgenommen wurde. Der Grund hierfür war die völlige Erschöpfung der Steuerkraft und das allmähliche Versagen des öffentlichen Kredits; denn die Staatsschuld war bei einer Jahreseinnahme von 24 Millionen Gulden seit Beginn des Krieges von 49 Millionen auf 136 gestiegen.
Zweifellos war Friedrich am Ende seiner Widerstandskraft angelangt. Sechs Jahre voll Hangens und Bangens hatte er gegen eine Welt von Feinden gerungen, um die politische Existenz seines Volkes, um seine nationale Ehre. Mit eiserner Willenskraft und Zähigkeit hatte er sich der Vernichtung entgegengestemmt; nun sah er das Verhängnis sich unaufhaltsam heranwälzen.
Da kam plötzlich Hilfe von unerwarteter Seite. Friedrich erhielt die Nachricht vom Tode der Zarin Elisabeth, die am 5. Januar einem Blutsturze erlegen war. Ihr folgte ihr Neffe, der Herzog von Holstein-Gottorp, als Zar Peter III., der ein eifriger Bewunderer Friedrichs war und nicht nur sofort Frieden mit Friedrich schloß, sondern auch ein Bündnis mit Preußen in Aussicht stellte. Am 19. Juni kam denn auch dieses Bündnis zustande, wonach Peter gegen das Versprechen des Eintretens Friedrichs für seine holstein-gottorpschen Erbansprüche 20 000 Russen unter Tschernyschew unmittelbar zu Friedrichs Verfügung stellte. Auch die Schweden waren des Krieges müde und machten aus Furcht vor den Russen ebenfalls mit Preußen Frieden.
Der sonderbare Umstand, nun dieselben Truppen beim preußischen Heere zu sehen, die dieses seit 6 Jahren mit Erbitterung bekämpft hatten, schien sowohl den Preußen als den Österreichern ein Traum zu sein. Man wollte es nicht glauben; man hielt es für ein ersonnenes Gerücht, um den Mut der Truppen zu beleben; alle Zweifel aber hatten ein Ende, als sich das russische Korps im Juni wirklich mit der Armee des Königs vereinigte.
Der Krieg nahm nun eine andere Gestalt an. Alle Staaten Friedrichs, von Breslau bis an die äußersten preußischen Grenzen, waren jetzt von den Feinden befreit und keine verheerenden Einfälle mehr zu befürchten. Der König verstärkte nun alle Teile seiner Armee, besonders seine leichten Truppen. Es wurden neue Freibataillone errichtet, desgleichen Freihusaren und Freidragoner. Auch die Artillerie wurde bedeutend vermehrt. Um ihr leichtere Bewegungen zu verschaffen und von ihrer furchtbaren Wirkung den bestmöglichen Nutzen zu ziehen, erfand er eine vortreffliche Methode, die die Österreicher bald darauf nachahmten. Er machte einige hundert Artilleristen beritten, die unter dem Namen »reitende Artillerie« neben dem leichten Geschütz hertrabten und auf diese Art imstande waren, der Kavallerie zu folgen und ihre Attacken wirksam vorzubereiten.
Die Österreicher versammelten nun zur Eröffnung des Feldzuges ihre ganze Macht in Schlesien, nachdem sie ein ansehnliches Korps zu der Reichsarmee geschickt hatten. Sie waren Meister von Glatz, von Schweidnitz und vom Gebirge. Dennoch war ihre Bestürzung über den Übergang der Russen zum Könige von Preußen so groß, daß Offiziere ebenso wie die gemeinen Soldaten die Sache ihrer Kaiserin als verzweifelt ansahen.
Da die Kaiserlichen eine Belagerung von Schweidnitz bestimmt erwarten mußten, so hatten sie den ganzen Winter hindurch außerordentliche Anstalten zur Verstärkung der Festung gemacht. 8000 Bauern und Soldaten mußten jede in der Umgebung liegende Anhöhe mit Schanzen versehen. Zudem hatte man der Festung 12 000 Mann auserlesener Truppen als Besatzung gegeben und sie reichlich mit Proviant, Munition und allen andern Bedürfnissen versorgt. Der General Guasco, ein durch Mut und Kriegserfahrung ausgezeichneter Offizier, wurde zum Kommandanten ernannt, und ihm ein tüchtiger Ingenieuroffizier beigegeben.
In diesem Zustande war Schweidnitz, als der König, mit dem russischen Korps vereinigt, vor der Festung anlangte. Daun stand auf den Anhöhen von Burkersdorf und Leutmannsdorf und ließ sich durch keine Unternehmung Friedrichs zu einer Veränderung seiner Stellung bewegen.
Inzwischen war in Rußland eine folgenschwere Veränderung eingetreten. Zar Peter, der sich durch unkluge Handlungen sowohl bei seiner Gemahlin Katharina wie beim russischen Volke unbeliebt gemacht hatte, wurde am 9. Juli durch Katharina vom Throne gestürzt und einige Tage später (ohne Vorwissen Katharinas) erdrosselt. – Friedrich war eben im Begriffe, die Österreicher auf ihren verschanzten Bergen anzugreifen, als er die Kunde vom Sturze des Zaren vernahm. Tschernyschew meldete sie ihm am 18. Juli nebst dem erhaltenen Befehl, mit seinem Korps sogleich die preußische Armee zu verlassen. Diese Begebenheit zerstörte den ganzen Plan des Feldzuges; denn der König mußte erwarten, daß das Korps in wenigen Tagen abermals zu seinen Feinden stoßen würde. Zwei Tage später konnte Tschernyschew ihm die beruhigende Nachricht geben, daß die Zarin den Frieden aufrechtzuerhalten wünschte. Der König hatte an demselben Tage eine lange Unterredung unter vier Augen mit dem russischen General, und es gelang seiner hinreißenden Art, diesen dermaßen zu bezaubern, daß er sich bereit erklärte, seinen Abmarsch um vier Tage hinauszuschieben, bis »genügende Anstalten zur Verpflegung seines Korps getroffen seien«. Das russische Korps blieb also ruhig in seinem Lager stehen. Während dieser Zeit hatte Friedrich das österreichische Lager unbemerkt umstellen lassen und den Angriff auf den 21. festgesetzt. In früher Morgenstunde des 21. wurde zunächst die nach Nordwesten gekehrte Hauptfront Dauns an den verschiedensten Punkten angegriffen, und bald ertönte auch Kanonendonner aus östlicher und nordöstlicher Richtung herüber, so daß der Feldmarschall völlig im ungewissen schwebte, wo der Hauptangriff erfolgen werde.
Das Korps des Grafen Wied stand gegen den rechten österreichischen Flügel. Während der Dunkelheit hatte es sich zum Angriffe formiert. Mit dem Eintreffen des Königs begann seine schwere Arbeit. Als es einem preußischen Regimente gelang, die rechte Flügelschanze im Rücken zu fassen, räumten die Kaiserlichen die Stellung des rechten Flügels. Das Korps hatte, wie sämtliche Berichte bekunden, Wunder an Tapferkeit getan, kämpfte es doch unter den Augen des Königs! Es hatte 25 Offiziere, 1570 Mann eingebüßt. Das Feuer der Batterie Moellendorf, die während der Nacht erbaut worden war, hatte für die Kaiserlichen völlig überraschend begonnen. Die erste Lage schlug in ein Kavallerieregiment ein, das am Waldrande abgesessen war und friedlich fütterte. Die entsetzten Pferde jagten mitten in ein Infanterieregiment hinein, rannten dieses nieder, dann rasten sie das enge Flußtal entlang, in dem sich die österreichische Bagage sammelte, brachten diese in Unordnung, um sich dann im Walde zu zerstreuen. Als nun Moellendorf vom Korps Wied die Nachricht erhalten hatte, daß der Angriff dort vorwärts gehe, ließ er seine Brigade ebenfalls antreten. Durch Umgehung bemächtigte er sich der Hauptschanze südlich Burkersdorf. Als dann der vor ihr liegende Verhau in Brand geriet, war bei den Österreichern kein Halten mehr. In wilder Unordnung strömten sie zurück, so daß Friedrich die weiteren Angriffsbefehle wieder zurückzog. Es blieb bei einer Kanonade, und in den ersten Nachmittagsstunden entschloß sich Daun, den allgemeinen Rückzug anzuordnen. Er bezog ein Lager hart an der böhmischen Grenze und gab damit die Verbindung mit Schweidnitz vollständig auf.
In der Morgenfrühe des folgenden Tages verließ Tschernyschew mit seinem Korps das preußische Lager, vom Könige mit einem goldenen, reich mit Brillanten besetzten Degen und 15 000 Dukaten beschenkt.
Nun stand der Weg nach Schweidnitz dem Könige von allen Seiten offen. Die Eroberung dieser Festung mußte jetzt allen übrigen Unternehmungen voraufgehen. Friedrich, Bevern und ein Kavalleriekorps standen an verschiedenen Stellen, um die Österreicher zu beobachten. Dahinter leitete der aus Breslau herangeholte Tauentzien die eigentliche Belagerung.
Auf die preußische Aufforderung zur Übergabe der Festung antwortete der Kommandant, General Guasco, »er würde suchen, den Ruhm der österreichischen Waffen zu behaupten und sich die Achtung Sr. preußischen Majestät zu erwerben.« Nun nahm am 7. August die Beschießung ihren Anfang und wurde Tag und Nacht ununterbrochen fortgesetzt. Ebenso lebhaft war die Verteidigung.
Die Belagerung war insofern merkwürdig, als zwei frühere französische Ingenieuroffiziere, Gribauval und la Fèvre, der erste in, der andere außerhalb der Festung wirkten. Gribauval stand noch in französischen Diensten und war wegen seiner bedeutenden Fähigkeiten zum österreichischen Heere gesandt worden. La Fèvre wollte die Festung hauptsächlich durch Minen bezwingen, erfüllte aber sein Versprechen nur unvollkommen, und man war schließlich genötigt, zum alten Verfahren zurückzukehren.
Unter und über der Erde wütete das Feuer. In den unterirdischen Horchgängen begegneten sich die beiderseitigen Mineure bisweilen, wo sie dann, solange sie durch Erdwände abgesondert waren, Stankkugeln gebrauchten, die mit dem ekelhaftesten Geruch Rauch und erstickende Dünste verbreiteten, nachher aber, wenn sie einander ansichtig wurden, mit ihren Pistolen kämpften. Über der Erde wütete der Kampf indessen unaufhörlich, bei Tag und bei Nacht, und brachte auf beiden Seiten Verluste, und auch manche ausgezeichnete Tat. So z. B. verteidigte der kaiserliche Hauptmann Brady ein Werk, aus dem seine Soldaten größtenteils geflohen waren, mit 15 Mann gegen 200 stürmende Preußen, die schon zum Teil die Brustwehr erstiegen hatten. Nachdem er die Geschütze hatte abfeuern lassen, ergriff er eine Sense und hieb damit auf die Stürmenden ein; die übrigen folgten seinem Beispiele. So wurden die Preußen zurückgeschlagen, und nachdem Brady Unterstützung erhalten hatte und sie auch im Rücken angriff, mußten sie nach erbittertem Kampfe das Unternehmen aufgeben.
Die Belagerung währte lange, bis endlich ein Zufall den Preußen zu Hilfe kam. Eine preußische Haubitzgranate schlug in ein Pulvermagazin des Fort Jauernick und entzündete das darin befindliche Pulver. Eine ganze Bastion des Forts mit zwei österreichischen Grenadierkompagnien flog in die Luft, 8 Offiziere und 200 Mann unter ihren Trümmern begrabend. Es war ein gewaltiger Riß in dem Festungsbau entstanden, und der Zugang für die Angreifer war erleichtert. In der darauffolgenden Nacht ließen die Belagerer eine Druckkugel springen, deren Wirkung erstaunlich war. Alle benachbarten Minengänge der Festung stürzten ein; dabei wurde ein Teil des gedeckten Weges in die Luft gesprengt, wodurch eine Bresche entstand. Nun trafen die Preußen alle Anstalten zu einem Sturm. Guasco aber wartete diesen nicht ab. Er ergab sich am folgenden Morgen. Es war am 9. Oktober, 63 Tage nach eröffneten Laufgräben. Die noch übrige Besatzung, 9000 Mann, wurde kriegsgefangen. – Die Belagerung kostete den Preußen rund 3000, den Österreichern 3500 Tote und Verwundete. Jene hatten dabei 172 163, diese 125 453 Bomben- und Kanonenschüsse getan.
Zum Glück hatten sich während dieser Zeit sein Bruder Heinrich und die Generale Seydlitz und Kleist in Sachsen tüchtig gehalten, und am 29. Oktober erfocht Prinz Heinrich bei Freiberg einen glänzenden Sieg über die Österreicher und Reichstruppen, der den größten Teil von Sachsen befreite. Diese Schlacht war zugleich die erste Feldschlacht Heinrichs und die letzte des Krieges.
Bald danach kam Friedrich selbst nach Sachsen. Er plante eine Eroberung Dresdens, um im Besitze der sächsischen Residenz bei den Friedensverhandlungen mit Nachdruck die Rückgabe von Glatz fordern zu können. Aber wenige Tage genügten, ihn davon zu überzeugen, daß die Kaiserlichen dieses Jahr ebensowenig an die Aufgabe Dresdens dachten wie im Jahre zuvor. Demnach blieb nichts übrig, als den Feldzug in Sachsen für beendigt anzusehen.
Mitte November schickte der König den Husarengeneral Kleist mit 6000 Mann nach Franken, mit dem Auftrage, Kriegssteuern einzutreiben, Pferde auszuheben und den Reichsständen noch einmal deutlich vor Augen zu führen, daß sie von Österreichern keinerlei Schutz erwarten dürften. Alle Reichsfürsten und Städte Süddeutschlands ergriff großer Schrecken. In Bamberg erhob Kleist eine Brandschatzung von 1 000 000 Talern, das stolze Nürnberg mußte 1 500 000 Taler zahlen. Die Reichsstadt Windheim setzte sich zur Wehr, weshalb sie geplündert ward und noch 12 000 Gulden Kriegssteuer zahlen mußte; Rotenburg ob der Tauber ergab sich vor 25 Husaren und kam mit 30 000 Gulden davon. Der preußische Gesandte beim Bundestage, Plotho, ward von allen Seiten um Hilfe angefleht. Als endlich Prinz Stollberg mit den Reichsvölkern auf Befehl von Wien her nach Franken kam, rückte Kleist mit seinen Eroberungen schon wieder in Sachsen ein, um Winterquartiere zu beziehen. Der Reichstag in Regensburg, der inzwischen das entscheidende Übergewicht erkannt hatte, das Preußen jetzt über Österreich errungen, beschloß nun völlige Neutralität und löste die Reichsarmee auf.
Auch im Westen war der Krieg zu Ende gegangen. Ferdinand von Braunschweig hatte die Franzosen durch manche schönen Erfolge Schritt für Schritt zurückgetrieben und ihnen am 24. Juni bei Wilhelmstal, in der Nähe Kassels, eine empfindliche Niederlage beigebracht, bald darauf auch das sächsische Hilfskorps bei Lutternberg geschlagen. Als Ferdinand dann auch Göttingen und Minden einnahm und am 1. November Kassel zur Kapitulation zwang, war der Krieg im Westen beendigt: zwei Tage später schloß Frankreich mit England den Frieden zu Fontainebleau.
Das mächtige Frankreich hatte von allen kriegführenden Mächten den Frieden am meisten ersehnt, da seine Finanzen völlig erschöpft, sein Handel außerordentlich geschwächt, seine Seemacht vernichtet und fast alle seine Kolonien in Asien und Amerika von den Briten erobert worden waren. Die Blindheit, womit Frankreich seine Heeresmacht für die Interessen Österreichs in Deutschlands einsetzte, anstatt sie jenseits der Meere gegen England zu verwenden, rächte sich jetzt bitter. Frankreich mußte einen großen Teil seiner nordamerikanischen Besitzungen an England abtreten, vor allem Kanada, Neufundland und das Ohiobecken.
Von Preußen war in Fontainebleau kaum die Rede. Die Bedingung im englisch-preußischen Vertrag, wonach keine der beiden Mächte einen Sonderfrieden ohne Wissen und Willen der andern schließen dürfe, schien von Lord Bute, dem Nachfolger Pitts, völlig vergessen. Die preußischen Besitzungen am Rheine, die von den Franzosen besetzt waren, sollten zwar von diesen geräumt werden, konnten aber nach dem Wortlaut ebensogut von Österreich sofort besetzt werden.
Die Londoner Bevölkerung, die zu den eifrigsten Verehrern Friedrichs gehörte, bewarf den Wagen Butes bei der Auffahrt zum Parlament mit Kot und Steinen, und Pitt hielt eine Rebe, worin er die Ausschließung Preußens von diesem Frieden als »hinterlistig, trugvoll, gemein und verräterisch« kennzeichnete. Er hielt der britischen Volksvertretung vor, daß Amerika in Deutschland erobert worden sei; denn wenn Frankreich nur einen Teil der Hunderttausende, die es Jahr für Jahr nach Deutschland gesendet habe, über dem Weltmeere verwandt hätte, so hätte es Kanada allemal behauptet. Nun aber blieb alles bei der vollendeten Tatsache. König Friedrich war schnöde von England verlassen worden.
Achter Teil: 1763
Bereits nach dem Falle von Schweidnitz und den Versuchen Rußlands, den Frieden zu vermitteln, hatte Daun seiner Gebieterin die traurige Ebbe im Staatssäckel kurz und bündig mit den Worten geschildert: »Wenn aus den Verhandlungen nichts werden sollte, folglich kein Friede zu hoffen, so sehe ich nicht, wie Ew. Majestät den Krieg werden fortführen können, da nach den obwaltenden Umständen sehr zu besorgen, daß die Armee nicht einmal mehr den Winter hindurch zu erhalten sein wird.« Maria Theresia aber war jetzt von dem heißen Wunsche nach Frieden beseelt. Bereits erwog sie in der Stille, ob sie sich nicht selbst an König Friedrich wenden sollte, da erschien wie ein rettender Engel November 1762 der sächsische Geheime Rat Saul in Wien, um die Dienste seines Hofes, der den Frieden aus naheliegenden Gründen am sehnlichsten wünschte, anzubieten. Österreich griff freudig zu, und es ward beschlossen, den sächsischen Geheimen Rat Freiherrn von Fritsch, der dem König von Preußen bereits bekannt war, ins preußische Hauptquartier zu senden. Dessen erste Audienz beim Könige verlief ziemlich resultatlos; erfolgreicher war eine zweite, die ihm am 19. Dezember gewährt wurde. Auf die schüchtern vorgebrachte Frage des Freiherrn: »Was machen Ew. Majestät aber mit uns armen Sachsen?« entgegnete Friedrich: »Ich gebe euch euer Land zurück, aber rechnet nicht darauf, ein Dorf oder einen Groschen von mir dazuzuerhalten.« Bei der nachfolgenden Mittagstafel sprach er dann mit besonders starker Betonung aus, daß er an eine Räumung des Kurfürstentums oder an die geringste Linderung der ihm auferlegten Lasten gar nicht denke, ehe der Friede unterzeichnet sei. In Warschau war man der günstigen Aufnahme Fritschs froh; aber man rechnete dort wie in Wien noch immer mit einem, wenn auch bescheidenen Länderzuwachs, vielleicht Erfurts, in Wien aber mit der Abtretung der Grafschaft Glatz.
Um die Weihnachtszeit war es gelungen, die Abgesandten der Höfe von Berlin (Legationsrat Hertzberg), Wien (Hofrat Collenbach) und Warschau (Geheimer Rat Fritsch) im sächsischen Lustschlosse Hubertusburg ihre Beratungen beginnen zu lassen. In der ersten Sitzung am 30. Dezember stellte Collenbach im Namen seiner Regierung die Forderung, die noch besetzte Grafschaft Glatz zu behalten, unter der Begründung, das »Interesse eines dauerhaften Friedens« verlange dies, weil die Grafschaft so weit südlich in das böhmische Gebirge hineinrage; für den »reellen Verlust« bot man eine Geldentschädigung an. Auf preußischer Seite ward der Forderung entgegengehalten, Daun habe Glatz für das Bollwerk von Schlesien erklärt; die angebotene Geldentschädigung lehnte der König schroff ab. Nun bot man in Wien den österreichischen Teil des Fürstentums Neiße als Tauschobjekt, und als dieser Vorschlag ebenfalls abgewiesen wurde, gab man die Wiedereinräumung der Grafschaft zu, verlangte aber eine Schleifung der Festungswerke. Auch das lehnte Friedrich rund ab. Da fügte sich endlich die Kaiserin, in den bedingungslosen Verzicht zu willigen.
Über diesen Verhandlungen war das Ende des Januar herangekommen. Die übrigen beiderseits gestellten Bedingungen erledigten sich ohne große Schwierigkeiten, so daß schon am 15. Februar die Friedensurkunden unterzeichnet werden konnten. Zwei Tage nachher begrüßte Friedrich seinen Unterhändler Hertzberg mit den Worten: »Ihr habt den Frieden gemacht wie ich den Krieg, einer gegen mehrere. Ich danke Euch für diese dem Staate geleisteten wichtigen Dienste.«
Mitte März bereiste Friedrich Schlesien, um den Schaden, den der Krieg in dieser Provinz angerichtet hatte, persönlich in Augenschein zu nehmen. Am 30. März kehrte er nach Berlin zurück, nachdem er diese seine Residenz seit 1757 nicht mehr betreten hatte. Als Vierundvierzigjähriger hatte er sie verlassen, voll Hoffnung, daß dieser Krieg wie seine beiden Vorgänger »kurz und vif« sein werde – als Greis kehrte er zurück, abgearbeitet, herb und mürrisch, nahezu bar aller Lebensfreude, die ihm in diesen furchtbaren sieben Jahren gründlich vergällt war.
Am Einzugstage hatte er über Frankfurt reisend das Kunersdorfer Schlachtfeld besucht, und die dort in ihm aufsteigenden Erinnerungen hatten ihn vollends trübe gestimmt. Es war 8 Uhr abends geworden, als er in Begleitung des Herzogs Ferdinand und seines Generaladjutanten im Wagen vor Berlin eintraf. Zahlreiche Bürger erwarteten ihn freudigen Herzens am Frankfurter Tore. Als es zu dunkeln begann, versahen sie sich mit Fackeln. Der König nahm jedoch einen Umweg und kehrte so in aller Stille in seine Vaterstadt zurück.
Die Preußen hatten in diesem Kriege, ohne die zahlreichen Treffen und großen Gefechte zu rechnen, in 16 Schlachten gefochten. Es wurden von ihnen und ihren Feinden 20 Belagerungen unternommen. Die Kriegskosten Friedrichs betrugen 139 Millionen Reichstaler, die er aus den gewöhnlichen Einkünften seiner Staaten, aus Sachsen, aus Mecklenburg und anderen feindlichen Ländern und aus England zog. Theresiens Kriegskosten hingegen überstiegen alle Einkünfte ihrer großen Monarchie so sehr, daß der Staat sich mit 100 Millionen neuer Schulden belastet sah. Am meisten aber hatte Frankreich verloren. Dieser Krieg kostete der Nation 677 Millionen Livres, und dies zu einer Zeit, wo die jährlichen Staatseinkünfte nur 307 Millionen betrugen.
Die Monarchen Europas befanden sich also nach sieben blutigen Jahren in Ansehung ihrer Eroberungsentwürfe auf demselben Punkte, von dem sie ausgegangen waren, nachdem Hunderttausende von Menschen ihr Blut vergossen hatten und Millionen Familien elend geworden waren. Dieser Krieg hatte Sachsen allein an Geld und Produkten aller Art 70 Millionen Reichstaler gekostet, und Europa hatte dabei über eine Million Menschen verloren. Alle Staaten, die an dem Kriege teilnahmen, der preußische allein ausgeschlossen, hatten ihre durch Steuern ohnehin hart gedrückten Länder mit ungeheuren Schulden belastet. Das Ziel der Feinde Friedrichs war nicht verrückt, sondern gänzlich verfehlt. Der Held, dessen Untergang in den Augen aller Sterblichen unvermeidlich schien, der selbst mitten unter seinen Triumphen an seiner Rettung zweifelte, machte jetzt Friede, ohne ein Dorf verloren zu haben. Napoleon urteilt daher treffend: »Nicht das preußische Heer hat sieben Jahre lang Preußen gegen die drei größten Mächte Europas verteidigt, sondern Friedrich der Große.«
*** ENDE ***