Buch:Vehmgerichte und Hexenprozesse in Deutschland
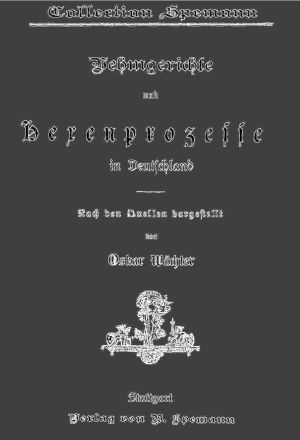
Nach den Quellen dargestellt
Vorwort.
Vehmgerichte und Hexenprozesse gehören einer längstentschwundnen Zeit an. Aber, von weittragender Bedeutung für ganz Deutschland, werfen sie Licht und Schatten über vier Jahrhunderte unsrer Geschichte. Und sind sie nicht heute noch von allgemeinem Interesse? Wer hätte nicht schon von Vehme und von Hexen gehört und gelesen? In Romanen und Dramen, in allerlei Erzählungen der Fremdenführer, in Sagen und Beschreibungen tauchen sie immer wieder auf. Und in der That haben diese mittelalterlichen Erscheinungen etwas ungemein Fesselndes bei aller unheimlichen Macht, welche sie auf das Gemüt des Hörers üben. Aber die Wenigsten wissen, wie es damit wirklich sich verhielt. Unkenntnis und Mangel an historischem Sinn ließen ein Gestrüppe irriger Vorstellungen aufwuchern, durch welche der wahre Sachverhalt vielfach entstellt und getrübt wurde.
Während die Vehmgerichte eine der großartigsten und ehrwürdigsten Gestaltungen des deutschen Volksgeistes mit Recht genannt worden sind, führen die Hexenprozesse tief in die Nachtseite der Menschheit und zeigen die finsterste Entartung eines geheimen Inquisitionsverfahrens, welchem Hunderttausende unglücklicher Menschen zum Opfer gefallen sind.
Die Bedeutung und das Wesen der Vehmgerichte läßt sich nur im Zusammenhang andrer Zustände des Mittelalters richtig erfassen. Die Rohheit des Faustrechts, die Grausamkeit der Strafen, sie bilden die Folie, auf welcher eine Darstellung der Vehme im rechten Lichte sich abheben muß.
Weit tiefer noch liegen die Wurzeln des Hexenwesens. Alle Zeiten, alle Völker wissen davon zu erzählen, als ob etwas allgemein Menschliches darin anklingen müßte. Aber wie ein schleichendes Gift zur verzehrenden Krankheit ausbricht, weil äußere Verhältnisse diesen Ausbruch begünstigten, so mußten auch für die verheerenden Hexenprozesse in Deutschland die Zustände aus der allgemeinen Rechtslage sich herausbilden und jene furchtbare Erscheinung möglich machen.
Populäre Darstellungen solcher Stoffe verfallen leicht in den Fehler der Oberflächlichkeit und Trivialität, während doch der gebildete Leser beanspruchen kann, daß ihm nur quellenmäßige Wahrheit, aber freilich nicht in unverdaulicher Form geboten werde. Dieser Anforderung suchen die folgenden Blätter gerecht zu werden.
Stuttgart, April 1882.
Einleitung. Mittelalterliche Zustände.
Ohne Zweifel hat es seine Berechtigung, wenn man von der Herrlichkeit des Mittelalters, seinen erhabenen Werken der Kunst und seinen kraftvollen Männern und ihren Thaten mit Bewunderung spricht. Wir staunen über die Bauten, die Kirchen und Klöster, die Burgen und den Schmuck der alten Städte, welche jene Zeit hervorgebracht, während sie doch an technischen Hilfsmitteln gar arm gewesen und keine Ahnung hatte von den Maschinen und Erfindungen aller Art, womit wir heutzutage so leicht arbeiten. Wir fragen: wie ist es möglich gewesen, damals und auf jener Stufe der Bildung, auf die wir herabzusehen gewohnt sind, solche Schöpfungen zu erstellen? Der große Künstler, welcher den gotischen Dom entwarf, der Maler, welcher unvergängliche Werte schuf, der Bildhauer, sie alle wurden damals wie heutzutage mit ihren hohen Anlagen geboren und suchten die Wege, sie auszubilden. Aber wie fanden sich die Tausende emsiger Hände, mit denen auch nur diese Steinmassen, deren es bedurfte, herbeigeschafft werden mußten? Schon diese Frage führt uns in eine Nachtseite des Mittelalters: die Leibeigenschaft, die Hörigkeit, die Frohndienste, mit deren Aufgebot die stolzen Ritterburgen und manch andre Bauten unter tausendfachen Bedrückungen des armen Volkes sich erhoben.
Und doch war das nur ein kleiner Teil des Drucks, unter welchem unsre Vorfahren vielfach gehalten wurden. Da und dort werden uns alte Türme gezeigt, Foltertürme, ausgestattet mit den entsetzlichsten Werkzeugen, um den menschlichen Leib langsam zu zerfleischen. Dann wieder: Drudentürme, d. h. Hexentürme, in deren schauerlichen Verließen die unschuldigen Opfer des Aberglaubens schmachteten, Folter und Tod erwartend.
Aber verweilen wir zunächst noch bei den Ritterburgen.
Wenn heutzutage dem Reisenden von kühnen Bergesgipfeln malerische Burgruinen winken und er sich in die Romantik der Ritterzeiten zurückträumt, so hat er meist keine Ahnung von dem Jammer und Elend, womit die übermütigen Adelsgeschlechter, welche aus jenen Burgen gehaust, Land und Volk umher in den Jahrhunderten des Faustrechts und der willkürlichen Fehden gequält haben. Ein kundiger Führer zu diesen Ruinen (Usener, Beiträge zu der Geschichte der Ritterburgen und Bergschlösser in der Umgegend von Frankfurt a. M.) hat aus den Frankfurter Archiven über die Thaten und Schicksale jener Geschlechter und Gauen anschauliche Mitteilungen gemacht. Da ist z. B. die Burg Eppstein, seit dem 12. Jahrhundert der Sitz mächtiger Dynasten. Die Eppsteiner hatten im Jahr 1416 eine Fehde mit dem Grafen Adolf von Nassau. Dieser verbrannte die Dörfer Delkelnheim, Breckenheim, Oberweilbach, Niederweilbach und die Höfe Mechtelnshausen und Harzach. Die Eppsteiner vergalten es reichlich; sie verbrannten alle Orte um Wiesbaden, Kale, Mosbach, Schirstein, Bibrich, Neurade, Kloppheim, Erbenheim, Niederhaus, Michelbach, Breidhard, Strintz und andre. – Von den Schloßruinen in Vilbel (eine Meile von Frankfurt a. M.) wird berichtet, daß dort seit Anfang des 13. Jahrhunderts ein Rittergeschlecht blühte. Im Jahr 1399 hatten die Ritter von Vilbel ihre Burg befestigt und wußten von da aus Zoll und Weggeld zu erpressen und die Gegend unsicher zu machen, bis die Stadt Frankfurt mit ihren Verbündeten das Schloß eroberte und zerstörte. Doch wurde es wieder aufgebaut, und nun erscheinen die Herren von Vilbel als gefürchtete Wegelagerer, die bald da, bald dort einen wehrlosen Kaufmann berauben. Ein Bechtram von Vilbel, »ein kühner, unruhiger Mann«, wurde wegen seiner Räubereien, die er auf offner Straße verübte, von den Söldnern der Stadt Frankfurt endlich mit seinen zwei Knappen gefangen genommen und folgenden Tages, am 27. August 1420, hingerichtet. »Auf der sogenannten Schütt vor dem Bockenheimer Thore war ein schwarzes Tuch hingebreitet, ein Kruzifix, zwei Lichter, Totenbahre und Sarg standen zur Seite. Dieses betrachtend und ohne sich die Augen verbinden zu lassen, wird Bechtram enthauptet. Die beiden Knappen wurden an gewöhnlicher Richtstätte hingerichtet.« Aber die Fehden und Gewalttaten hatten ihren Fortgang. In einer solchen Fehde eines Hans Walbrunn gegen die Stadt Friedberg im Jahr 1448 wurden in dieser Stadt sechshundert Häuser niedergebrannt.
Eine andere in jener Reihe der fehdelustigen ist die Burg Reiffenberg in der Nähe des Feldbergs, des höchsten Gipfels am Höhe-Gebirg. Die Reiffenberger gehörten zu den ältesten und angesehensten Rittergeschlechtern der Gegend. Mit dreifachen Mauern war die Burg umgeben und ihr Turm ragte wohl dreißig Meter über den Fels empor. Aber was erzählen diese Ruinen? auch sie waren Zeuge von vielen Fehden, Wegelagerung und dergleichen. Namentlich haben die Ritter in ihren Fehden der Stadt Frankfurt manches Leid zugefügt. So wird berichtet: »Walther von Reiffenberg trieb am 7. Juli 1406 den Frankfurtern zweiundzwanzig Hammel weg und beraubte die Meßkaufleute; Philipp von Reiffenberg ward am 24. Oktober 1410 der Stadt Feind und überfiel im Jahr 1411 zwei Bürger aus Frankfurt, die in eignen Geschäften ritten, bei Cloppenheim und nahm ihnen das ihrige. Zu gleicher Zeit nahm er zwischen Dortelweil und Gronan zwei Einwohner aus ersterem Ort gefangen, beraubte und brandschatzte sie. In Gronau verbrannte er das Frankfurter Eigentum u. f. f.« Erst im Jahr 1419 gelang es dem Erzbischof von Mainz, diese Fehde zu begleichen. Aber bald brachen die Zwistigkeiten von neuem los. Die Ritter trieben der Stadt das Vieh weg, fingen Bürger und Knechte, plünderten, verbrannten ein Dorf. »Dies alles geschah aus dem Schloß Reiffenberg.«
Nicht weit von Reiffenberg erheben sich die Trümmer der Burg Haustein. Schon im Jahr 1379 mußte »wegen der Uebergriffe und Missethat, die aus der Festen Hatzstein und darin geschehen« die Burg von den Städten Mainz, Frankfurt, Friedberg und mehreren Reichsfürsten »von Landfriedens wegen« belagert werden. Sie wurde erobert und die Hattsteiner verpflichteten sich, ihre Erben und Nachkommen, daß »aus Hattstein oder darin, auf Straßen, auf Wasser oder auf Lande kein geistlicher Mann, Pilgrim, Kaufmannschaft, Juden noch andere unschädliche Leute nimmer sollen angegriffen oder geschädiget werden«. Wer dagegen handelt, soll »damit treulos, ehrlos, meineidig und in des Reichs Acht sein«. Allein die Ritter setzten sich über alle Verträge und Landfrieden weg, versuchten fortan in Fehden ihr Heil, und kein Jahr verging mit ihnen in Ruhe. Aus der Burg Hattstein wurden ungescheut die gewohnten Räubereien fortgetrieben. Wiederholt und im Jahr 1399 auf Befehl des Landvogts am Rhein wurde die Burg belagert. Während einer dieser Belagerungen wurde das Dorf Arnoldsheim geplündert, Kirche und Schule verbrannt. Keine Mittel, auch der Landfrieden nicht, waren hinreichend, dem Unwesen zu steuern. Besonders Frankfurt war den fortgesetzten Gewaltthätigkeiten der Ritter aussetzt, die mit ihrer Raubsucht oft die ausgesuchtesten Grausamkeiten gegen wehrlose Gefangene verbanden. Wegen der fortgesetzten »große viel und mancherlei Räuberei, Schinderei, Mord und Brände«, von den Hattsteinern begangen, schritt der Rat der Stadt Frankfurt abermals zu Fehde und Belagerung, im Jahr 1429, doch ohne Erfolg. Das Unwesen wurde immerhin fortgetrieben: Klöster, Dörfer, Land und Leute empfanden die Raubsucht der Hattsteiner. Im Jahr 1430 fing Konrad von Hattstein einen wehrlosen Mann, brandschatzte ihn und warf ihn ins Gefängnis, wo er wahnsinnig wurde und starb. Einen Bürger von Assenheim mißhandelte er auf gleiche Weise; lebenslang blieb derselbe lahm. Einen andern Mann, den Konrad der Junge fing, ließ er unter nichtigem Vorwand ermorden. »Glaube, Recht und Treue schien in dem Geschlecht erloschen.« Abermals verbündeten sich die benachbarten Fürsten und Städte im Jahr 1432 und sandten am 2. August »bei Sonnenschein und schönem lichtem Tag« die Fehdebriefe in die Feste, die sie am folgenden Morgen berennen und stürmen ließen und noch desselben Tages eroberten.
Diese Beispiele ritterlichen Treibens, welche Usener aus dem Umkreis weniger Meilen zusammenstellt, ließen sich durch zahllose ähnliche aus der Geschichte der Ritterburgen in allen deutschen Gauen vermehren, und welch unermeßliche Last von Gewaltthat und Elend ist von ihnen auf Tausende wehrloser Menschen gehäuft worden!
Während der arme Mann, wenn er auch nur einen kleinen Diebstahl verübte, am Galgen büßen mußte und seine Verbrechen mit den grausamsten Strafen verfolgt wurden, wußte sich der mächtige Räuber, der Ritter, welcher, wie man es nannte, »sich auf Reuterei verlegte« oder »vom Sattel« oder »vom Stegreif lebte«, jeder gerichtlichen Ahndung zu entziehen. Da mußte hie und da der Kaiser selbst einschreiten. So hat einst Rudolf I. auf einem Zuge nach Thüringen neunundzwanzig ritterliche Landfriedensbrecher aufknüpfen und sechsundsechzig Raubschlösser zerstören lassen und ebenso auf einem Zuge nach Schwaben bei Calw fünf Raubschlösser zerstört. Aber im ganzen wurden nur selten solche Exempel statuirt. Denn der deutsche Kaiser, sehr häufig selbst in Kriegszüge oder Fehden verflochten, fand wenig Zeit und hatte meist nicht einmal die Macht, den Frieden im Lande gegen solche Uebergriffe des Ritterwesens zu wahren.
Dazu kam, daß die Fehde im Mittelalter auf einem allgemein anerkannten Recht beruhte, dessen Grenzen nur freilich sehr vielfach weit überschritten wurden. Um dieses Fehderecht in seinem Wesen richtig aufzufassen, ist es nötig, auf die altgermanischen Rechtszustände zurückzublicken. Hier war der Staatsverband im Sinne des heutigen Staatsrechts noch gar nicht vorhanden, oder doch nur ein sehr mangelhafter. Es war zumeist dein einzelnen überlassen, sich wegen erlittener Verletzung Genugthuung zu verschaffen. Nur die Sitte, gestützt auf ihre Handhabung durch die Volksgenossen, schuf gewisse Ordnungen, welche späterhin auch dem geschriebenen Recht, den Gesetzen, einverleibt wurden.
Nach dieser altgermanischen Auffassung hatte derjenige, welcher böswillig einen andern verletzte, mit diesem den Frieden gebrochen, sich mit ihm in einen Kriegsstand gesetzt. Dabei hatte der Verletzte seine Familie und seine Freunde und Genossen zur Seite und sie hatten seiner sich anzunehmen. Sie konnten nun gegen den Friedbrecher Fehde erhebenund in seinem Blute Genugthuung suchen und damit dem Verletzten wieder Frieden verschaffen. Doch galt dies Fehderecht nur bei wissentlicher Verletzung; wer bloß durch fahrlässige Handlung eines andern geschädigt war, konnte in der Regel lediglich eine »Buße« in Geld beanspruchen. Ueberdies war die Ausübung des Fehderechts noch an gewisse Schranken gebunden, so z. B. durfte in seinem Hause kein Befehdeter angegriffen oder verfolgt werden. Auch konnte der König dem Befehdeten seinen Königsfrieden erteilen und dadurch ihn gegen die Fehde schützen.
Verschieden von diesem altgermanischen ist das mittelalterliche Fehderecht, welches späterhin in seinen Ausartungen zum Faustrecht, zur Herrschaft roher Gewalt, geführt hat.
Als nämlich seit Karl dem Großen der Staatsverband überall ein festerer wurde, mußte die Staatsgewalt sich auch als Strafgewalt entschiedener ausprägen. War doch die gesamte Rechtsordnung die öffentliche Sicherheit und der allgemeine Frieden (im germanischen Sinn) durch ein schweres Verbrechen, durch Brand, Raub, Mord, offne Gewaltthat verletzt und daher nicht bloß der verletzte Einzelne, sondern der Staat selbst in der Lage, Genugthuung zu fordern, eine Genugthuung, welche in öffentlicher körperlicher Strafe an Leib oder Leben des Missethäters bestehen mußte. Daß der Staat gegen Verbrecher mit Strafe einzuschreiten habe, war zugleich eine Anforderung der Kirche, welche immer größere Macht auch in weltlichen Dingen erreichte; sie aber lehrte, daß die Obrigkeit das Schwert führen und damit Strafe gegen die Bösen vollziehen solle. Stets aber war das Einschreiten des Gerichts durch Klage von seiten des Verletzten oder seiner Angehörigen bedingt.
Nun wäre es allerdings konsequent gewesen, das Fehderecht völlig abzuschaffen und jede Selbsthilfe des Verletzten und seiner Genossen gesetzlich zu verbieten. Allein dem standen zwei Umstände entgegen. Noch war die altgermanische Anschauung im Volke mächtig, welche es zu den wichtigsten Rechten des freien Mannes zählte, sich wegen erlittner Verletzung selbst die Genugthuung zu nehmen. Sodann wäre ein Verbot der Fehde nur unter der Voraussetzung durchführbar gewesen, daß die Strafgewalt des Staats bei allen Verbrechen hätte einschreiten können. Dazu aber fühlte sich der Staat nach den damaligen Verhältnissen zu schwach. Häufig konnte der Verbrecher im Vertrauen auf seine und seiner Verbündeten Macht jeder richterlichen Ladung Trotz bieten und sich dem Vollzug des Urteils entziehen.
Es konnte sich also nur um Einschränkung und gesetzliche Regelung des Fehderechts handeln, zunächst in der Richtung, daß nur noch wegen schwerer Rechtsverletzungen Fehde erhoben werden durfte; solche Verbrechen hießen fortan Friedensbruchsachen. Die Reichsgesetze, in welchen bezüglichen Normen gegeben wurden, sind die sogenannten Landfrieden.
Aber die Gesetzgebung ging im Verlauf der Zeit noch weiter. Und damit wurde die entscheidende Wendung vollzogen, an die Stelle des altgermanischen ein ganz andrer Grundsatz gestellt. Der Verletzte sollte zunächst den ordentlichen Richterangehen und auf dem Weg der Klage die Bestrafung des Verbrechers und eben damit seine Genugthuung für die erlittne Verletzung suchen. Die Strafen, welche in Anwendung kamen, waren meist überaus hart und grausam. Aber sie konnten in vielen Fallen nicht erkannt oder nicht vollzogen werden, weil das Gericht des Angeklagten nicht habhaft zu werden vermochte. Für solche Fälle nun mußten auch Kaiser und Reich ein Recht zur Selbsthilfe anerkennen und die Fehdezulassen. Konnte der Richter dem Verletzten nicht Recht schaffen, so durfte dieser sich selbst Genugthuung nehmen und zwar auf dem Wege der Fehde. In diesem Falle, und nur in diesem Falle, war die Fehde eine rechtmäßige, ohne daß übrigens fernerhin zwischen groben und leichten Rechtsverletzungen unterschieden worden wäre. Aber auch die rechtmäßige Fehde wurde an gewisse Formen und Beschränkungen gebunden, um teils die Lage des dadurch Bedrohten zu erleichtern, teils die öffentliche Ruhe zu sichern. Es sollte dem Gegner – so forderte es ja schon der Grundsatz ritterlicher Ehre – Zeit gelassen werden, sich auf Gegenwehr zu rüsten, und Bedenkzeit, ob er nicht dem Verletzten Abfindung und anderweitige Genugthuung geben möchte. Es mußte also der wirklichen Fehde eine Ansage vorhergehen. Diese geschah in einem Fehdebrief, den ein Bote bei Tag in die Wohnung des zu Befehdenden bringt. In dem Fehdebrief benennt der Fehdelustige seinen Gegner und sich und in der Regel auch den Grund der Fehde, erklärt, daß er des andern Feind sein wolle, und verwahrt seine Ehre wegen aller Folgen durch den offnen Absagebrief.
So bestimmt schon der Reichsabschied von Nürnberg vom Jahr 1187: »Wir setzen auch und bestimmen durch dieses Edikt, daß, wer einem andern Schaden zuzufügen und ihn zu verletzen beabsichtigt, ihm mindestens drei Tage vorher durch eine sichre Botschaft absagen soll. Würde der Verletzte in Abrede ziehen, daß ihm vorher abgesagt worden sei, so soll der Bote, wenn er noch lebt, schwören, daß er von seiten seines Herrn zu bestimmter Stelle und Zeit abgesagt habe; ist der Bote tot, so soll der Herr in Verbindung mit zwei wahrhaften Männern schwören, daß er ihm abgesagt habe.«
Der kaiserliche Landfriede von 1235 sagt: »Was auch jemanden widerfahre – daß er das nicht räche! er klag es seinem Richter, es sei denn, daß er sich zur Not muß wehren seines Leibes und seines Gutes. Wer seine Klage aber anbringt: wird ihm nicht gerichtet, und muß er durch Not seinen Feinden widersagen, – das soll er thun bei Tage, und von dem Tage an bis an den vierten Tag soll er ihm keinen Schaden thun, weder an Leib, noch an Gut; so hat er drei Tage Frieden.«
Endlich schrieb der Reichsabschied von 1442 vor: »Niemand soll dem andern Schaden thun oder zufügen, er habe ihn denn zuvor zu gleichen billigen landläufigen Rechten (d. h. vor Gericht) erfordert (im Weg der Klage), und wenn ihm solches Recht vielleicht nicht so bald, als er wollte oder begehrte, gedeihen oder widerfahren möchte: so soll er dennoch seinen Gegner nicht angreifen oder beschädigen, er habe denn vorher alles das völlig und ganz gethan und vollbracht, was Kaiser Karls IV. goldne Bulle enthält und ausweist.«
Damit in Ausübung des Fehderechts nicht Ausschreitungen zum Schaden von dritten Unbeteiligten und Störungen des allgemeinen Verkehrs vorkommen möchten, hatten gewisse Personen, Orte und Gegenstände ihren besondern Friedenund durften in keiner Weise aus Anlaß einer Fehde geschädigt werden. Solchen Frieden hatten Geistliche, Pilger, schwer Kranke, Kaufleute und Fuhrleute, Weingärtner und Ackerleute, mit ihren Geräten, Kirchen und Kirchhöfe.
Eine weitere Schranke in Ausübung des Fehderechts lag in dem von der Kirche eingeführten Gottesfrieden. Kraft desselben mußte an gewissen Festtagen und in jeder Woche von Mittwoch abend bis Montag früh jede Fehde ruhen. Dieser Gottesfrieden wurde allwöchentlich besonders eingeläutet. Wer ihn verletzte, fiel in den Kirchenbann, und wenn er sich aus diesem nicht in gewisser Frist lösen konnte, in die Reichsacht.
Wer nun gegen diese gesetzlichen Normen handelte, wer Fehde begann, statt seine Sache vor Gericht zu bringen, oder in Ausübung des Fehderechts jene Schranken übertrat, der hatte den Frieden gebrochen; er war Landfriedensbrecher und mit der Strafe des Stranges bedroht.
So lautete die gesetzliche Vorschrift. Aber ganz anders sah es im wirklichen Leben aus. Den deutschen Adel des Mittelalters beseelte eine unbändige Rauflust und die vielen Kriege nährten auch in andern Kreisen die Neigung zu allerlei Gewaltthat. Sehr oft diente das Fehderecht zum Vorwand, räuberische Absichten zu verfolgen. Viele Fehdebriefe aus jener Zeit erwähnen gar nicht eines besondern Grundes der Fehde, sondern enthalten eben die nackte Erklärung, daß man des andern Feind sein wolle. Selbst gegen wohldisziplinierte Reichsstädte, in denen doch gewiß Justiz zu erlangen war, wurden noch im 15. Jahrhundert Fehden begonnen. So lautet z. B. ein Fehdebrief an die Reichsstädte Ulm und Eßlingen vom Jahr 1452 so: – »Wisset Ihr Reichsstädte, daß ich Claus Dur von Sulz und ich Waidmann von Deckenpfronn, genannt Ganser, und ich Lienhard von Bercken, genannt Spring ins Feld, Euer und aller der Eurigen Feind sein wollen, von wegen des Junker Heinrich von Isenburg. Und wie sich die Feindschaft fürder macht, es sei Raub, Brand oder Totschlag: so wollen wir unsre Ehr mit diesem unserm offnen besiegelten Brief bewahrt han.«
Selbst wenn die Fehde einen rechtmäßigen Anfang hatte, mußte sie bei der Rohheit der Zeiten leicht zu den gröbsten Gewaltthaten führen. Denn nun wurden die Güter des Gegners verwüstet, seine Gutsangehörigen und Hintersassen vergewaltigt, – und der arme Landmann mußte mit seiner Haut die Händel seines Gutsherrn bezahlen. Dieser letztre freilich nahm wieder Rache an den Besitzungen des Befehdenden – allein was gewannen dadurch seine armen Leute? Ein Markgraf rühmte sich einst, er habe in seinen Fehden 170 Dörfer verbrannt!
Besonders ein Umstand war es, wodurch die Fehden der allgemeinen Sicherheit höchst gefährlich wurden. Es galt für erlaubt, sich der rechtmäßigen Fehde eines andern anzuschließen. Da gab es nun viele Raubritter von Handwerk und viele verdorbne Leute, welche sich stets bereit finden ließen, auch die ungerechteste Fehde zu unterstützen und bei dieser Gelegenheit überall zu rauben und alle Gewaltthat zu üben.
Diese Zustände eines allem Recht Hohn sprechenden Faustrechts wurden in ganz Deutschland als eine wahre Landplage empfunden. Und doch währte solche Herrschaft roher Gewalt und kräftiger Fäuste bis gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, nur wenig gezügelt durch den ritterlichen Sinn, durch einzelne energische Kaiser, durch den Einfluß der Kirche und durch die Entwicklung der Städte.
So war es einem Verbrecher nur gar zu leicht möglich, den Gerichten sich zu entziehen und sogar auch ihnen offen zu trotzen im Vertrauen auf seine Burg und auf seine und seiner Genossen Fäuste. Der Schwache und Wehrlose wurde unterdrückt und mußte alle Unbill über sich ergehen lassen.
Inmitten dieser anscheinend unentwirrbaren Rechtlosigkeit und gegenüber der Unmacht fast aller Gerichte sehen wir in Westfalen einfache Volksgerichte, von Ungelehrten, meist Bauern besetzt, sich erheben, einen Hort des Rechts für jeden durch Verbrechen Geschädigten. Es sind dies die Vehmgerichte, welche bald mit unwiderstehlicher Macht ihrer Ladung und ihrem Richterspruch bis an die fernsten Grenzen des deutschen Reichs Geltung zu verschaffen wußten.
Immerhin aber war es ein ungesunder Zustand, wenn wegen Machtlosigkeit der einheimischen Gerichte der Freistuhl auf roter Erde auch von dem in andern Gauen des Reichs Verletzten angerufen werden mußte. Es galt daher, das entartete Fehderecht völlig zu beseitigen. Dies geschah, zunächst freilich noch auf dem Papier, auf wiederholtes Andringen der Reichsstände und Kaiser Maximilians I. im Jahre 1495 durch den sogenannten ewigen Landfrieden. Durch dieses Reichsgesetz wurde das Reichs-Kammergericht, welches für Ordnung und Frieden im Reiche sorgen sollte, neu organisiert, das Fehderecht ganz aufgehoben und jede Fehde bei Strafe des Landfriedensbruchs verboten. Aber noch lange Zeit wurde das Verbot übertreten, so daß es Sprichwort war: man traue dem Landfrieden nicht.
Die Gerichte gelangten allmählich zu größerem Ansehen und ausreichender Machtstellung. Aber im Strafverfahren selbst vollzog sich eine tief einschneidende Aenderung. An Stelle des alten Anklageverfahrens schritt man mehr und mehr von Amtswegen ein. Für diesen inquisitorischen Prozeß bildete sich ein geheimes und schriftliches Verfahren. Den Beweis der Schuld suchte man vorzugsweise durch Geständnis des Verdächtigen zu erbringen. Und hiebei geriet man auf die folgenschwerste Verirrung, nämlich darauf, das Geständnis durch die Folter zu erpressen. In ihrer grauenhaftesten Ausbildung sehen wir die Folter Jahrhunderte hindurch – in den Hexenprozessen gehandhabt.
Charakteristisch für die mittelalterlichen Zustände sind auch die schon oben berührten Strafarten in ihrer furchtbaren Mannigfaltigkeit. Auf eine sehr große Anzahl von Verbrechen war Todesstrafe gesetzt, und zwar nicht nur die einfache, durch Strang, Ertränken, Enthauptung, sondern in vielen Fällen eine geschärfte Todesstrafe: Rädern, Vierteilen, Pfählen, Verbrennen, Totsieden in Oel oder Wasser, Lebendigbegraben, Aushungern; ferner Todesstrafe mit vorhergehenden Schärfungen, wie Abhauen der Hand, Reißen mit glühenden Zangen. Vielfach fanden Anwendung verstümmelnde Strafen der grausamsten Art: Abhauen von Hand, Fuß, Abschneiden von Nase, Ohren, Lippen, Zunge; sodann Kerker in abscheulichen Löchern, mitunter lebenslang. Auf leichten Vergehen stand der sogenannte Staupenschlag d. h. Aushauen mit Ruten durch den Henker oder Züchtigung mit Stockstreichen. Als beschimpfende Strafe war der Pranger in Uebung. Dabei herrschte bei den Gerichten, in Ermanglung eingehender Gesetze, die größte Willkür in Erkennung und Vollzug der Strafen. Namentlich die Städte übten, um die öffentliche Sicherheit aufrecht zu erhalten, die grausamste Justiz, damit abschreckende Exempel statuiert würden und weil man meinte, gegen einen Verbrecher, als Feind des Gemeinwesens, sich alles erlauben zu dürfen.
Als endlich im Jahr 1532 ein Strafgesetzbuch für das deutsche Reich zustande kam, die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karl V., die sogenannte Carolina, fanden sich zwar die Gerichte in ihrer Willkür einigermaßen beschränkt, aber die grausamen Strafen und die Folter waren, wie es der Charakter jener Zeit mit sich brachte, auch in die Carolina übergegangen. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts trat in dieser Beziehung eine durchgreifende Reform ein.
In welcher Weise die mittelalterliche Justiz zu verfahren pflegte, darüber geben namentlich die »schwarzen Register«, »Achtbücher« und »Blutbücher«, welche in den meisten Städten geführt wurden, Auskunft. Das »Achtbuch« bezieht sich auf die Ausgewiesnen und Flüchtlinge. Es mußte nämlich den Städten ganz besonders darum zu thun sein, schädlicher und unruhiger Leute loszuwerden. Sie wiesen sie deshalb aus, auf Zeit oder für immer; letzteres entweder geradezu oder in der Form einer Zeit, welche der Ausgewiesene nicht überleben konnte, z. B. auf 101 Jahre; und kamen Ausgewiesene vor der Zeit zurück, so wartete ihrer ohne weiteres harte Strafe, gewöhnlich die Todesstrafe. Oft begnügten sich die Gerichte selbst bei schweren Verbrechen mit der Ausweisung; man war doch des Menschen los; kam der Ausgewiesne unbefugt zurück, so konnte ihm schon deshalb wieder kurzer Prozeß gemacht werden: es ging ihm dann an den Hals. So sagt ein Statut der Stadt Köln vom Jahr 1437 von einem solchen, der aus der Stadt verwiesen wird: Kommt er wieder und ist es ein Mann, dem soll man sein Haupt abschlagen; ist es eine Frauensperson, die soll man lebendig begraben. Von einem solchen Verbrecher sagte man, er sei »auf seinen Hals verzellt«, d. h. er wurde ausgewiesen und, kam er zurück, hingerichtet. Um nun aber dem Ausgewiesenen, wenn er zurückkam, zu beweisen, daß er »verzellt« sei, legte man besondere Achtbücher an. In diese Achtbücher wurden die Ausgewiesnen, aber auch sonst Geächtete und Anrüchige eingetragen. In Koblenz wurde im Jahr 1317 ein Buch angelegt, in welches gröbere Verbrecher eingetragen werden sollten, um sie, wie es im Buche heißt, »vom guten Bürger unterscheiden und ihnen das, was sie verdienen, seinerzeit zukommen lassen zu können«. In diesem Buche wird nun der Verbrecher und sein Verbrechen kurz angeführt und bei denen, welche, wenn man sie ergreifen würde, der Todesstrafe gewärtig sein sollten, bloß ein Kreuz gemacht. –
In dem Blutbuche von Basel steht unter dem Jahre 1358: »Zöpfler soll fünf Meilen von der Stadt nimmermehr sein wegen des bösen Leumunds, der auf ihm ist, und breche er's, so soll man ihn ohne Gnade ertränken.« Ferner: »Der Salzschreiber Konrad von Ulm soll ewiglich leisten (d. h. verbannt sein), und wenn er sich dennoch betreten läßt, so soll man ihm ohne Urteil das Haupt abschlagen.« Ferner: »Niklas soll ewiglich für eine Meile leisten (d. h. eine Meile weit verbannt sein), weil er falsche Gulden in die Stadt gebracht hat; breche er das, so soll man ihn in einem Kessel sieden.«
Häufig führte man in den Blutbüchern ein fortlaufendes Verzeichnis aller vom Gerichte gefällten Urteile, ein Verzeichnis, welches man wohl das schwarze Register nannte. Selbst für diejenigen, die nur ein geringeres Verbrechen begangen hatten und mit leichter Strafe davonkamen, war es mißlich, in einem solchen Register zu stehen, weil jeden, der in dem Register stand, oder der, wie man es auch ausdrückte, »an den Brief gesetzt« war, die Nachteile des Uebelberüchtigten trafen, und es erklärt sich daraus wohl unser sprichwörtlicher Ausdruck »im schwarzen Register stehen«. Mit diesem schwarzen Register wurde nicht selten grober Mißbrauch getrieben, indem man wegen sehr geringer Vergehen leicht in dasselbe kommen konnte, und die Urkunden jener Zeit haben uns manche bittere Klagen einzelner Bürger darüber, daß sie wegen unbedeutender Veranlassung ins schwarze Register gesetzt und dadurch in Unglück gestürzt worden, aufbehalten.
In manchen Orten wurden besondre Register über besondre Verbrechen geführt, so z. B. in Basel im Jahr 1416 ein sogenanntes Totenbuch angelegt, in welcher jeder Meineidige und Eidbrüchige eingeschrieben werden sollte, »daß er ewiglich ein verworfener Mensch sei, aller Ehre und Aemter entsetzt, zu keinem Zeugen genommen und ein Jahr verwiesen sein soll.«
Jene Blutbücher nun geben über die Strafen, welche vom 13. bis zum 16. Jahrhundert in Anwendung kamen, sehr interessante Aufschlüsse. So findet sich in einem derartigen Buch, welches die Stadt Freiberg im Jahr 1423 anlegte, ein »schwarzes Register« von solchen, die »auf ihren Hals verzellt« wurden, d. h. in der Art in die Acht erklärt, daß, wenn man ihrer habhaft würde, sie unbedingt hingerichtet werden sollten, und dieses Verzellen auf den Hals kommt bei den verschiedensten Verbrechen vor, selbst bei sehr geringfügigen, bei solchen Übertretungen und Vergehen, die man heutzutage bloß polizeilich ahnden würde. So heißt es z. B. in jenem Buche: »Die Richter haben lassen verzellen Opatz Vogeler auf seinen Hals, darum, daß er freventlich Bier geschenkt hat, und da die Richter nach ihm sandten, da wollte er nicht kommen. Item die Richter lassen verzellen Himmelblau darum, daß zwei Messer bei ihm begriffen, und die doch verboten sind, auf seinen Hals.« Ferner: »Die Richter haben lassen verzellen Hans Rodenstock auf seinen Hals, darum, daß er bei Nacht auf der Gasse geschrieen: Wasser her, daß die Leute darob erschrocken sind und wollten meinen, es wäre Feuer.« Ferner: »Unsere Herren lassen verzellen Burkhardt Nickel darum, daß er ein brennendes Faß auf seinem Haupt vom Markt bis in die Weingasse getragen hat.« »Item meine Herren lassen verzellen den jungen Stroll darum, daß er am Charfreitag zu Wein gesessen und unziemliche Worte daselbst getrieben, auf seinen Hals.«
Die Blutbücher geben in schauerlicher Kürze Kunde von den erkannten und vollzogenen harten Strafen. Namentlich wurde die Todesstrafe sehr häufig mit grausamen Schärfungen in Anwendung gebracht. So finden wir die Strafe des Siedens (bei lebendigem Leibe) bald in Oel, bald in Wein, bald in Wasser nicht selten erkannt und vollzogen; ebenso eine der härtesten Strafen: das Lebendigbegraben und das Pfählen (wobei dem Verurteilten ein spitzer Pfahl ins Herz gestoßen wurde), oft noch mit Schärfungen, z. B. daß dem Gepfählten glühende Kohlen unter den Leib gelegt wurden. Besonders häufig finden sich diese Strafen, namentlich das Lebendigbegraben, gegen Frauen angewendet, (auch mit der Schärfung, daß der Delinquentin eine Dornhecke auf ihren Leib gelegt und sie nun mit Erde beschüttet werden soll) bei Verbrechen, auf welchen für Männer der Strang oder das Schwert gesetzt war. So setzt z. B. das Lübecker Recht vom Jahr 1266 fest, daß jede Frauensperson, welche einen mit dem Strang bedrohten Diebstahl begeht, lebendig begraben werde; und daß dieses Recht Jahrhunderte lang streng angewendet wurde, beweisen die Blutbücher von Lübeck. Urteile, wie folgendes, sind in denselben sehr häufig: »Anna Pipers, gebürtig von Wittenberg, hat bekannt, daß sie stahl einen Frauenrock, darum ist sie lebendig begraben unter dem Galgen.« Sogar nachdem im 16. Jahrhundert ein neues Lübecker Stadtrecht das Lebendigbegraben überging und bestimmte, daß Weibspersonen wegen Diebstahls mit dem Schwert gerichtet werden sollen, findet es sich doch noch später in dem Blutbuche aus dem Jahre 1575 bis 1592, daß Weibspersonen lebendig begraben wurden.
Aus andern Blutbüchern sieht man, wie diese Strafen allmählich abkamen. So heißt es in einem Nürnberger Blutbuche: »Als 1513 Meister Diepolt, der Henker, des Schellenklausen Tochter, eine Diebin, unter dem Galgen lebendig begrabensollte, hat sie sich so sehr gesträubet, daß sie sich die Haut an den Armen, Händen und Füßen so sehr aufgerissen, daß es den Henker sehr erbarmt und er den Rat gebeten, keine Weibsperson mehr also lebendig begraben zu lassen«; und wirklich wurde auch beschlossen, künftig die Weiber wegen Dieberei zu ertränken und ihnen etwa vorher die Ohren abzuschneiden, statt lebendig zu begraben. Bei diesem Ertränken der Weiber hat man es verschieden gehalten. Gewöhnlich wurden sie in einen leinenen Sack gebunden und in diesem ins Wasser geworfen; an manchen Orten aber warf man sie frei ins Wasser und dies gab dann nicht selten Veranlassung, sie zu begnadigen, wenn sie sich aus dem Wasser wieder herauszubringen wußten. So wurde z. B. nach dem Blutbuche von Basel im Jahre 1602 eine Kindsmörderin zum Ertränken verurteilt und in den Rhein geworfen; sie kam aber lebendig bei dem Thomasthore aus dem Wasser heraus und die Juristenfakultät erklärte nun, daß sie ihre Probe bestanden habe, und so wurde sie mit der Vermahnung, sich ehrlich zu halten, heimgeschickt. Nach demselben Blutbuche von 1634 ging es wieder ebenso bei einer Kindsmörderin, welche, als sie lebendig aus dem Wasser gezogen worden, bei Strafe des Schwerts verwiesen wurde. Allein bei diesem Anlaß gab der Rat die Verordnung, daß künftig dergleichen malefizische Weibspersonen nicht mehr mit dem Wasser, sondern mit dem Schwert hingerichtet werden sollten.
Die Blutbücher des 15. Jahrhunderts zeigen, wie man verhältnismäßig geringe Vergehen oft mit den härtesten Strafen zu ahnden pflegte. So wurden z. B. im Jahre 1456 in Nürnberg zwei Krämer, weil sie den Safran, den sie verkauften, gefälscht hatten, mit ihrer Waare lebendig verbrannt und ein Weib, das ihnen geholfen hatte, lebendig begraben.
Auch von den verstümmelnden Strafen, Handabhauen, Ohrenabschneiden u. dergl., sind die Blutbücher jener Zeit voll. Oft wurden sie in ganz besondrer Weise erkannt. So verurteilte ein Holsteinisches Gericht im Jahr 1466 einen Mann, der die Jungfrau Maria gelästert habe, dahin, daß man ihm seine Zunge auf den Block annageln soll, bis er sich selbst freimache. Ein ähnliches Urteil enthält das Blutbuch von Lübeck aus dem Jahre 1566; es wurden zwei Männer, welche auf einen andern bei Händeln das Messer gezückt hatten, verurteilt, daß »ihnen durch ihre linke Hand ein Messer geschlagen werden soll, welches sie selbst ausreißen mögen, und sie dann aus der Stadt verwiesen werden sollen, nicht wieder zu kommen, ohne der Obrigkeit Erlaubnis, bei Strafe des Strangs«.
Noch grauenvoller wird das Bild, wenn wir zugleich die »peinliche Frage« wirken sehen; z. B. eine Frau wird auf falschen Verdacht, ein Stück Silberzeug einem Kaufmann entwendet zu haben, hervorgerufen durch eine übelwollende Nachbarin und andere böse Zungen, in Haft genommen. Sie weiß nichts zu gestehn. Die Anwendung der Folter wird zulässig erkannt. Im Bewußtsein ihrer Unschuld übersteht sie die ersten Grade. Das Gericht will ein Resultat. Der Henker wird angewiesen, daß er der Verdächtigen schärfer zusetze. Endlich mit zerbrochenen Gliedern, ihrer nicht mehr mächtig, gesteht sie alles, was man von ihr wissen will: sie kann nicht mehr. Das Urteil lautet: sie soll nach drei Tagen lebendig begraben werden. Wer kann die Schrecken dieser Todesart würdigen? und welch entsetzliche Angst muß die Arme ausstehen! Es ist keine Rettung. Sie wird bei vollem Bewußtsein ohne Erbarmen lebendig begraben.
Dergleichen Beispiele von der Härte und Grausamkeit mittelalterlicher Justiz ließen sich viele anführen. Sie werden nur überboten durch die Schrecken der Hexenprozesse. Wie ganz anders, ein leuchtendes Vorbild echter Volksjustiz, erscheinen ihnen gegenüber die Vehmgerichte. Von beiden reden die folgenden Blätter.
Erste Abteilung. Die Vehmgerichte.
Erster Abschnitt. Zwei Erzählungen.
Die technischen Ausdrücke finden ihre Erklärung im zweiten Abschnitt.
I. Auf roter Erde.
Die üppigen Kornfelder reiften der Ernte entgegen. Auf den stattlichen Bauerhöfen, unter dem Schatten der Eichen und Linden entfaltete sich reges Leben. Es war zu Anfang Juli im Jahr 1425. Die hellstrahlende Morgensonne hatte schon den Tau von den Wiesen genommen, die Lerchen jubelten unter dem blauen Himmel.
Zwei Wanderer gingen raschen Schrittes auf der Landstraße zwischen Soest und Unna. Der ältere, Hermann Grote, ein stattlicher Bauer, etwa sechzig Jahre alt, der jüngere, Gerhard Struckman, Doktor der Rechte zu Soest, beide in eifrigem Gespräch. »Wenn Heineman Weffer,« begann Struckman nach einer Pause, »den Johann Laske wirklich erschlagen hat, so wird wohl kein Zeuge dabei gewesen, er selbst aber der That nicht geständig sein. Dieser Mord hat viel Redens gemacht durch ganz Westfalen. Aber es wurden von der Obrigkeit keine weitern Schritte gethan, auch ist kein Haftbefehl erlassen werden. Ueberall hieß es: die Vehme wird's an Tag bringen. In andern Ländern würde man Verdächtige eingekerkert, in hartem Gefängnis mürbe gemacht, durch die peinliche Frage zum Geständnis gemartert haben. Nichts von alledem. Man hat nur gehört, daß der Freistuhl auf Anklage eines Schöffen Ladung gegen den der That verdächtigen Weffer erlassen habe. Und – wird er sich stellen? wird es zum Spruch kommen und zum Vollzug?« – »Ihr seid ein Gelehrter,« entgegnete Grote, »und haltet vielleicht nicht viel auf unsern Rechtsgang. Aber – folgt Weffer der Vorladung und wird er auf gichtigen Mund oder auf Eid des Klägers gerichtet, so scheint ihm die Abendsonne nicht mehr.«
»Als ich« – nahm Struckman nach einer Pause das Wort – »von meinen Studien und Reisen wieder in die Heimat kam, nachdem ich in andern Ländern den Rechtsgang gesehen, da erkannte ich, daß unsere uralten Volksgerichte mit mehr Kraft und Erfolg für Recht und Gerechtigkeit wirken, als die geschriebenen Gesetze und die gelehrten Richter irgendwo es vermögen. Die heimliche Acht ist für jeden Unwissenden in undurchdringliches Geheimnis gehüllt, und doch tagt sie unter freiem Himmel bei lichtem Sonnenschein, hat keine bewaffneten Häscher, hat weder Gefängnis noch Folter – aber es folgt die Ladung, und wenn er sie verachtet, das Urteil dem Schuldigen vom Meer bis zu den Alpen, bis es ihn trifft, unfehlbar mit tötlichem Stoß. – Ich bin noch nicht Wissender und es sei ferne, daß ich euch mit unziemlicher Frage lästig werde. Indes könnt ihr mir wohl sagen, ob es dem unwissenden Manne gestattet ist, dem offnen Ding anzuwohnen?«
»Auf diese Frage« – erwiderte Grote – »will ich euch gerne Bescheid geben. Das freie Gericht unter Königsbann handelt im offnen Ding über den Angeklagten, wenn er der Ladung gehorsamt und nicht selber ein Freischöffe ist. Weffer ist kein wissender Mann. Stellt er sich also ein, so bleibt allen Freien der Umstand unverboten. Im andern Falle läßt der Freigraf durch den Freifrohnen die heimliche Acht entbieten, und welcher Unwissende danach im Umkreis des Freistuhls getroffen wird, hat sein Leben verwirkt. Ein mehreres darf ich euch nicht sagen, denn jeder Schöffe muß der heiligen Vehme Heimlichkeit wahren. Wir sind jetzt am Königsweg, der zum Freistuhl führt. Nun mögt ihr auf euer eigen Abenteuer weiter gehen. Gehabt euch wohl, gegen Abend mag sein, daß wir uns wieder treffen.«
Mit diesen Worten verließ Grote seinen Begleiter und gesellte sich zu mehreren Hofbesitzern, die gleichfalls den Königsweg einschlugen. Auch sie waren Freischöffen. Bald hatten sie den Hügel erreicht, auf dessen Gipfel ein alter Hagedorn den steinernen Tisch überschattete. Der Tisch war auf drei Seiten von einer steinernen Bank umgeben. Auf dem Tische lag ein blankes Schwert und ein von Weiden geflochtener Strick. Der Freigraf Lord Hake, ein bäuerlicher Mann von ehrwürdigem Ansehen, und die erschienenen Freischöffen, zwanzig an der Zahl, nahmen Platz. Der Freigraf richtete an den Freifrohnen die üblichen Fragen wegen der rechten Besetzung des Gerichts, der Befugnis des Freistuhls, den Königsbann zu üben, und der ordnungsmäßigen Ladung des Angeklagten; nach gegebner Antwort auf alle diese Fragen ließ der Freigraf den Ankläger und den Angeklagten wegen Ermordung des Johann Laske von Unna zum offnen gebotenen Ding aufrufen. Der Freifrohne verkündigte hierauf, daß als Ankläger erschienen sei Berndt Kopper, Freischöffe zu Unna, auch der Angeklagte in Person. Da nun, ließ der Freigraf ansagen, das Gericht über einen anwesenden unwissenden Mann zu halten obliege, so werde die Verhandlung im offnen Ding eröffnet und sei jedem freien großjährigen Manne der Zugang verstattet.
Lautes Murmeln durchflog den Umstand, die zahlreich sich herandrängenden Männer, die aus der Nähe und Ferne gekommen waren, – als Heineman Weffer, ein hagerer Mann von 30 Jahren mit stechenden grauen Augen und rotem Vollbart, kecken Schrittes auf den Freistuhl zuschritt.
Lautlose Stille lag auf der Menge, als der Freigraf dem Berndt Kopper das Wort erteilte und dieser nun vortrug, daß er kraft der allgemeinen Rügepflicht der Freischöffen Klage erhebe gegen Heineman Weffer. Dieser sei am Sonntag nach Ostern abends mit Johann Laske im Krug vor dem Walde gesessen bis der Mond aufgegangen und mit ihm aufgebrochen; zwischen beiden seien heftige Worte gefallen. Am andern Morgen fand man den Laske im Wald erstochen, nicht weit von dem Toten ein Messer, welches Weffer kurz vorher in Unna gekauft habe. Weffer habe den Mord verübt. Uebrigens weise auch das ganze Benehmen des Angeklagten auf seine Schuld; er sei nach der That ruhelos umhergelaufen und habe oft bei Nacht, wie von dem Hauswirt erzählt worden, laut aufgeschrieen, offenbar von schwerer Angst gepeinigt. Als der Verdacht auf ihn gefallen und die Ladung der Vehme ergangen, da sei er stundenlang in dumpfes Brüten versunken und daraus wie in jähem Schreck wieder aufgefahren. Daß er nun heute persönlich erscheine, beweise keineswegs, daß er sich schuldlos fühle, sondern nur, daß er nicht zu entfliehen vermöge, wisse er ja doch, daß, wenn er nicht erschiene, er unfehlbar der Acht und dem Tode verfalle; nicht entfliehen lasse ihn aber auch der Zeuge im Innern, das belastete Gewissen. Kläger erbiete sich, seine Anklage nach allen Teilen mit zwei Eidhelfern zu beschwören, und sollte der Angeklagte dawider sechs Eidhelfer finden, so wolle Kläger die sieben Hände mit vierzehn Eiden echter Freischöffen niederlegen und überbieten.
Der Freigraf ordnete dem Angeklagten einen Vorsprecher aus der Zahl der Schöffen bei und forderte ihn auf, durch dessen Mund sich seines Lebens und höchster Ehre wegen zu verantworten. Weffer gab kurz und barsch die Erklärung, daß er völlig in Abrede stelle, der That schuldig zu sein, welcher man ihn aus arger Mißgunst zeihe.
Der Freigraf ließ ihm nun das Messer, welches in der Nähe des Ermordeten gefunden worden war, vorweisen und verlangte, daß Weffer dasselbe in seine rechte Hand nehme. Zögernd that dies der Angeklagte und in diesem Augenblick verließ ihn seine Fassung, – sichtlich erbleichte er, – doch gab er das Messer mit dem Bedeuten zurück, er habe dasselbe nie besessen.
Hierauf wurde dem Ankläger verstattet, nach Freistuhls Recht mit seinen zwei Eidhelfern unter Vorhalten des Schwertes feierlich zu beschwören, daß sie die Anklage für wahr und durchaus glaubhaft halten.
Der Kläger und Angeklagte traten zurück. Der Freigraf bezeichnete den Schöffen Hermann Grote als Urteilsfinder. Dieser ging weg, gefolgt von den Freischöffen, mit denen er sich kurze Zeit beriet, dann wiederkam, und nachdem die Schöffen ihren Platz wieder eingenommen, sich bereit erklärte, das Urteil zu schelten. Die Schöffen erhoben sich und wiesen für Recht, und ihren Spruch verkündigte der Freigraf: daß man den Angeklagten Heineman Weffer solle nehmen und hängen ihn an den nächsten Baum zwischen Himmel und Erde.
Der Freigraf nahm den Weidenstrick vom Tische, übergab ihn dem Freifrohnen, dieser den beiden jüngsten Schöffen, und nun ergriffen sie den Verurteilten und führten ihn weg.
Nach kurzer Weile kam der Frohnbote wieder, legte einen neuen aus Weiden geflochtenen Strick zu dem Schwert auf den Tisch und der Freigraf eröffnete die Gerichtssitzung wieder. Zwei Boten des Freistuhls, welche eine Ladung zu überbringen gehabt, waren von den Bürgern einer kleinen Stadt am Rhein ihres Auftrags wegen gefangen gehalten worden. Die Anklage wurde vorgetragen und als »Vehmwroge« erklärt, auch festgestellt, daß die Ladung an die angeschuldigten Bürger ordnungsmäßig ergangen und die Frist von 6 Wochen und 3 Tagen verstrichen sei. Dreimal wurden die Beklagten aufgerufen, sie waren nicht erschienen. Das Gericht mußte versammelt bleiben und ihrer warten, bis die Sonne auf dem höchsten stand. Nun verwandelte sich das offne Ding in das Stillgericht, die heimliche Acht. Der Vehmfrohne entbot jedem unwissenden Manne, sich zu entfernen.
Als gegen Abend Grote den Heimweg angetreten, traf er am Königsweg auf Struckman, welcher ihn hier erwartete und seine Befriedigung über das, was er gesehen und gehört, aussprach. »Ich sah den verurteilten Weffer zwischen Himmel und Erde hängen und ich weiß, daß die Vehme recht gerichtet hat. Mit solchen Gerichten ist Westfalen gut versorgt und ihr bedürfet fürwahr nicht der Rechtsgelehrten und ihres Rates.«
II. Macht in die Ferne.
Im Oktober des Jahres 1429 wurde zu Nürnberg eine gar stattliche Hochzeit gehalten. Der Ratsherr Tucher verheiratete seine jüngste Tochter Mechtild an den Bürgermeister Pferinger von Nördlingen. Aus weiter Ferne kamen die Gäste herbei. Die Herbergen waren von Pferden und Reisigen besetzt. Denn in jenen Zeiten des Faustrechts schien es nicht geraten, ohne Bedeckung zu reisen. Besonders lebhaft war es in der Herberge »zur goldenen Au«. Sie lag dicht am Thor, wo die Landstraße nach Nördlingen einmündete. Der geräumige Saal faßte kaum die Gäste, die ihr Mittagsbrot heischten und dem Würzburger Weine, der hier verzapft wurde, tüchtig zusprachen. Viele von ihnen schienen Kaufleute zu sein.
An einem kleinen Tisch im Erker saß ein großer blonder Mann in bäuerlicher Tracht. Seine kleinen blauen Augen musterten mit scharfem Blicke die Gäste. Einer der Eintretenden schien seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er trug einen Jagdanzug und auf der Schulter die Büchse, die er an der Wand aufhing und sich nun dem Bauersmann gegenüber setzte mit leichtem Gruß. Beiden wurde das Mittagessen vorgesetzt. Der Jäger nahm das Messer, welches neben seinem Teller lag, auf und legte es so, daß es mit der Spitze gegen seine Brust zielte, und sah dabei seinen Nachbar an. Dieser legte in demselben Augenblick sein Messer in derselben Weise. Zwischen beiden entspann sich eine Unterhaltung. »Nach eurer Kleidung zu schließen,« sprach der Jäger, »seid ihr nicht aus dieser Gegend.« »So ist's,« antwortete der andre; »ich komme vom Niederrhein und habe ein Geschäft hier in Nürnberg.«
Beide verzehrten schweigend ihr Mahl und leerten ihre Krüge. Der Jäger stand auf und trat zu seinem Gewehr. Der andre folgte ihm, trat neben ihn, legte seine rechte Hand auf des andern linke Schulter und sagte leise: »Ich grüß euch, lieber Mann, was fangt ihr hier an?« Sofort legte der Jäger gleichfalls die rechte Hand auf des Bauern linke Schulter und erwiderte, den andern Gästen unvernehmbar: »Alles Glücke kehren ein, wo die Freienschöppen sein!« Darauf sprach der Jäger die Worte: »Strick, Stein« und der andre sagte dazu: »Gras, Grein«.
»Erlaubt mir, daß ich euch begleite,« sagte der Bauer und beide verließen den Saal und gingen schweigend ins Freie. Hier unter den Bäumen vor dem Thor nahm der Bauersmann wieder das Wort: »Es ist mir lieb, daß ihr ein Wissender seid. Könnt ihr hier abkommen?«
Darauf der Jäger: »Habe mich auch auf roter Erde zu Dortmund unter der Linde wissend machen lassen. Aber was ist euer Begehr?«
»Ich heiße Konrad Oilpe, wohne ganze nahe bei Dortmund und habe eine Sache an den Kuntz von Schweinsberg. Falls ihr den kennen möchtet?«
»Und ich bin Friedrich von Eberbach, ansässig zwei Stunden von hier auf Burg Eberbach. Den Schweinsberg kenne ich wohl und habe etlichemal ihn bei Gefreundten getroffen. Er ist kurzer Hand und macht nicht viel Worte.«
»Ist euch auch kund worden,« begann Oilpe wieder, »daß Herr Kuntz vor nun gerade einem Jahr zwei Kaufleute auf offner Straße überfallen, den einen erschlagen, den andern auf Lösegeld festgesetzt hat?«
»Habe davon vernommen,« antwortete der von Eberbach. »Aber wie kommt ihr an die Sache? oder – sollte die heimliche Acht – ?«
»Will es euch berichten,« entgegnete Oilpe, »Herr Kuntz hat seinen Gefangnen drei Monate in einem abscheulichen Verlies festgehalten, bis endlich das Lösegeld – 300 Goldgulden – herbeigeschafft war. Danach hat der Eingekerkerte geklagt, aber gegen den mächtigen Raubritter kein Recht gefunden. Darüber ist er gestorben. Seine Witwe war mit einem Freischöffen verwandt und brachte die Sache vor den Freistuhl zu Dortmund. Sie wurde als Vehmwroge erkannt, die Ladung gegen den Angeklagten ausgefertigt und zweien Freischöffen überantwortet. Diese haben denn auch alsbald die Reise angetreten und da sie zu Nürnberg vernahmen, es sitze der Angeklagte auf einem Schloß, darein man ohne Sorg und Abenteuer nicht kommen möchte; so sind sie bei Nacht vor die Burg des Kuntzen geritten und haben aus dem Rennbaum drei Spähne gehauen und den Ladungsbrief in die Kerben gesteckt und dem Burgwächter zugerufen, sie hätten einen Königsbrief an das Thor gesteckt und er sollte dem, der in der Burg ist, sagen, daß er seines Rechtstags warte an dem freien Stuhl bei den höchsten Rechten und des Kaisers Bann. Das habe denn auch der Burgwächter seinem Herrn berichtet mit großem Schrecken, der aber habe gespottet und gesagt: »Hans, meinst wohl, ich scheue die heilige Vehme? Die soll ihre Boten nicht wieder an mich schicken.« Nun, ihr wisset, wie die Sache weiter verlaufen mußte. Der Geladne erschien nicht. Am letzten Termin hatte man auf ihn gewartet unter der Vehmlinde, bis die Sonne auf dem Höchsten gewesen. Als darauf der Freigraf gefragt, ob niemand von seinetwegen da sei, der ihn verantworten wolle zu seinem Rechte und seiner höchsten Ehre, und niemand vorgetreten, so wurde nun dem Beistand der Witwe gewiesen, daß er die Klage beweisen solle. Der hat denn auch sofort den feierlichen Eid geleistet auf des Freigrafen Schwert vor gespannter Bank mit zwei Eidhelfern, die beschworen, der Ankläger schwöre rein, nicht mein.
Es war aber zur gespannten Bank nicht bloß die nötige Zahl von sieben, es waren zwanzig Schöffen erschienen, und die haben einmütig auf des Freigrafen Frage das Urteil gesprochen, daß der Angeklagte der That schuldig sei. Darauf hat der Freigraf den Kuntz von Schweinsberg vernehmt und gerufen: er weihe seinen Hals dem Stricke, seinen Leichnam den Tieren und Vögeln in der Luft, ihn zu verzehren, und befehle seine Seele Gott im Himmel in seine Gewalt, wenn er sie zu sich nehmen will, und setze sein Leben und Gut ledig, sein Weib solle Witwe, seine Kinder Waisen sein. Darauf hat der Graf genommen den Strick von Weiden geflochten und ihn aus dem Gerichte geworfen und allen Freischöffen geboten und sie bei ihren Eiden und Treuen, die sie der heimlichen Acht gethan, ermahnt, sobald sie den vervehmten Mann bekommen, daß sie ihn henken sollen an den nächsten Baum, den sie haben mögen, nach aller ihrer Macht und Kraft.
Weil nun der Ankläger, der Freischöffe Niklas vom Steinhof, selber krank geworden und auf den Tod gelegen, hat er mir das Urteil der heimlichen Acht, vom Freigrafen ausgefertigt, zu vollziehen übergeben. Und so bin ich nun hier und ersuche euch bei eurem Eid, daß ihr mir Beistand thun wollet!«
»Weigern darf ich's nicht,« erwiderte Friedrich von Eberbach, »wiewohl es kein leichtes Werk sein wird. Auch müssen wir, wie ihr wisset, noch einen Freischöffen suchen, da nur ihrer dreie miteinander nach Freistuhls Recht den Spruch vollziehen mögen.«
Oilpe ergriff die Rechte des andern und sagte: »Ich kann mich auf euer Wort verlassen. Auch wisset ihr, daß nach Freistuhls Recht, wenn ein Schöffe, den wir aufrufen, des Freigrafen Brief und Siegel stehet, er zur Hilfe verbunden ist, mag es auch gegen Freund und Bruder gehen. Ihr seid hier ortskundig. Suchet einen Wissenden, der uns guten Beistand leisten möge und Gelegenheit schaffen, daß wir den Vervehmten da antreffen, wo ein Baum in der Nähe ist.«
»Ihr möget unbesorgt sein,« erwiderte Friedrich. »Gehet nur wieder in die Herberge zurück; dahin will ich euch ein Brieflein senden und euch bescheiden. Ich suche den Schweinsberg, gehe ins Tuchersche Haus und ehe die zweite Nacht kommt, werden wir den vervehmten Mann fest machen.«
Des andern Tages hielt der Ratsherr Tucher eine Jagd im Forst an der Pegnitz. Unter einem Zelt lagerte die Gesellschaft zum Morgenimbiß in fröhlicher Stimmung. Die Hörner riefen zum Aufbruch – schon sah man einzelne Rehe am Rand der Wiese vorübertreiben. Der Ritter von Schweinsberg, ein starker rothaariger Mann, bestieg sein Pferd. Neben ihm hielt Friedrich von Eberbach. Beide ritten schweigend miteinander in den Wald. »Ihr wollt eine Sache mit mir ausmachen?« begann der von Schweinsberg. »Ich habe nicht lange Zeit.« »So gestattet mir, daß ich noch zwei Männer rufe, die auch zur Sache gehören,« erwiderte Friedrich und stieß plötzlich zweimal in sein Jagdhorn. »Ich ersuche euch aber, mit mir abzusteigen, daß ihr einen Brief lesen möget, der euch nahe angeht.«
In diesem Augenblicke traten zwei Männer eilenden Schrittes heran, Konrad Oilpe und der Ratsherr Tucher. Oilpe näherte sich dem von Schweinsberg, indes Friedrich zum Ratsherrn sich stellte. Oilpe zog das Vehmurteil hervor und hielt es dem von Schweinsberg unter Augen. Dieser erblaßte, griff aber an sein Jagdgewehr und wollte sich zur Wehre setzen. Alsbald fand er sich von den ehernen Fäusten des Westfalen gepackt und an einen Baum gedrückt, daß er sich nicht zu rühren vermochte. Mit schäumendem Mund rief er: »Herr Ratsherr, schützt euren Gast vor meuchlerischem Ueberfall!« Aber Tucher legte die Hand auf seinen Arm und sprach: »Hier ist kein Verrat! ihr seid der kaiserlichen Acht und dem Spruch der heiligen Vehme verfallen. Dawider kann euch nicht die Stadt Nürnberg, noch ich als ein einzelner schützen. Auch bin ich als Schöffe dem Freistuhl pflichtig.«
Und in demselben Augenblick hatte Konrad Oilpe den aus Weiden geflochtenen Strick zur Hand, legte ihn unter Handreichung Eberbachs dem Vervehmten um den Hals und sie henkten den Mann an den Ast einer Eiche. Darauf zog Oilpe ein Messer hervor, das er neben den Geächteten in den Baum steckte.
Der Ratsherr aber ging zu seinen Gästen zurück und gab ihnen zu wissen, daß an der Eiche auf dem Niederbühl der von Schweinsberg durch die Vehme gerichtet sei.
Des andern Tages führte der Bürgermeister von Nördlingen seine junge Frau heim. Der Ratsherr Tucher und einige Freunde des Hauses gaben ihm das Geleite bis zur nächsten Station. Hier sollte der zweite Frühtrunk genommen werden; die warme Herbstsonne lockte die Gäste auf die Wiese vor dem Wirtshaus. Da saßen auch Friedrich von Eberbach und Konrad Oilpe. Beide erhoben sich. Eberbach ging auf den Ratsherrn zu, bot ihm den Willkomm und sagte: »Es ist mir ganz erwünscht, daß ich euch noch einmal treffe, so unlieb es mir und zumeist wohl euch gewesen, daß ich bei der Hochzeit und dem gestrigen Jagen stören mußte. Daran aber trägt die Schuld mein Begleiter Konrad Oilpe, den ich euch hier vorstelle und der mich zum Dank noch ein Stück Weges begleitet hat.«
Tucher und Pferinger zeigten sich erfreut, einen Schöffen vom hochberühmten Dortmunder Freistuhl zu treffen und einen Vertrauten des angesehenen Freigrafen Konrad von Lindenhorst, konnten sie doch nicht wissen, ob nicht heute oder morgen die gewaltige Vehme auch über Nürnberg oder Nördlingen ihre Hand ausstrecken möchte.
»Noch habe ich ein besonderes Anliegen an euch,« sagte Tucher zu Oilpe. »Ich weiß, was es auf sich hat, Freischöffe zu sein, und wünsche, daß auch mein Schwiegersohn von der heimlichen Acht aufgenommen werde. Auch der Rat zu Nördlingen wünscht dasselbe. Nur hat Pferinger noch immer gezögert, nach Westfalen zu reisen, war auch unsicher, an welchen Freistuhl er sich wenden möge.« Pferinger bestätigte das und Oilpe bot ihm die Hand und sagte: »Nun, wohledler Herr Bürgermeister von Nördlingen, lasset es nicht länger anstehen. Wenn der Mai ins Land kommt, so wollet euch aufmachen und nach Dortmund reisen; von da kommt ihr in zwei Stunden auf meinen Hof und sollet als Gast willkommen sein. Ich führe euch zum Freigrafen Lindenhorst und die Sache wird bald im reinen sein.«
Tucher forderte jetzt den Friedrich von Eberbach und Konrad Oilpe auf, noch mit der Frau Bürgermeisterin anzustoßen, die sich denn auch bald mit den Fremden im Gespräch befand. Als von der Reise Pferingers nach Westfalen die Rede war, meinte Eberbach scherzend, vorher müsse er sich versichern, ob seine junge Frau nicht neugierig sei, da er ja, wolle er wissend werden, mit hohem Eidschwur sein Leben verpfände, das Geheimnis der Vehme geheim zu halten »vor Weib und Kind, vor Sand und Wind«. Aber die Bürgermeisterin entgegnete: damit habe es keine Gefahr, dafür sei ihr Gemahl selbst Manns genug. Uebrigens sei sie die Tochter eines Freischöffen und werde es für hohe Ehre achten, auch eines Wissenden Frau zu sein.
Zweiter Abschnitt. Ursprung und Verfahren der Vehmgerichte.
Noch heute sind vielfach die abenteuerlichsten Vorstellungen von den mittelalterlichen Vehmgerichten verbreitet. Man erzählt schauerliche und unheimliche Geschichten, wie sie bei Nacht, in unterirdischen Gewölben oder im Waldesdickicht unter allerlei Vermummung und furchterregenden Gebräuchen ihre Sitzungen gehalten und mit grausamen Foltern und Strafen ihre Opfer gepeinigt, oder ihre Gefangenen in entsetzlichen Kerkern hätten verschmachten lassen.
Mit dergleichen Phantasiegebilden übertüncht man noch immer eine der ehrwürdigsten und großartigsten Erscheinungen des deutschen Mittelalters.
Die Vehmgerichte waren altgermanische Volksgerichte, die unter freiem Himmel, bei lichtem Sonnenschein sich versammelten, auf Anklage freier Männer, auf freier Männer Eid oder freies Geständnis richteten. Sie hatten weder Kerker noch Folter, sie erkannten nicht auf die grausamen Strafen der mittelalterlichen Kriminaljustiz – sie hatten nur eine Strafe, die sie im ganzen deutschen Reich gegen jeden Vervehmten in Anwendung brachten.
Diese westfälischen Vehmgerichte sind in den Zeiten der allgemeinen Rechtsunsicherheit, da Faustrecht und Fehde in Deutschland walteten, ein mächtiger Hort des Rechts gewesen. Mit unwiderstehlicher Macht und Strenge, mit einer Gewalt, die an den fernsten Grenzen des deutschen Reichs den Schuldigen ergriff, übten sie Gericht mit mehr Kraft und Ansehen, als Kaiser und Landesherren es vermochten.
Mitglied der heiligen Vehme, Freischöffe, Wissender, Vehmgenosse zu sein, galt für die höchste Ehre des freien Mannes. Und wer es wagen mochte, der Ladung dieser Gerichte und ihrem Königsbanne zu trotzen, der war keinen Tag sicher, ob ihn nicht die vernichtende Wucht der über ihn ausgesprochnen Acht treffen möge.
Die Vehmgerichte in Westfalen führten ihre Einsetzung auf Karl den Großen zurück. Dieser habe die alten Volksgerichte, welche er dort vorfand, ausdrücklich bestätigt und ihnen den Königsbann, die höchste Gerichtsbarkeit über Leben und Tod, im Namen und aus Vollmacht des deutschen Königs und römischen Kaisers zu üben, erteilt. Auf diese Einsetzung, als ihr geheiligtes Recht, haben die Freistühle sich jederzeit berufen, selbst gegen die Landesherren und kaiserlichen Gerichte. In betracht dieses Königsbanns heißt noch jetzt der zum Freistuhl führende Weg an vielen Orten der Königsweg.
Manche wollen auf den Königsbann oder Blutbann, welchen diese Gerichte übten, auch den Ausdruck »rote Erde« zurückführen, welcher eben das von Freistühlen bedeckte Westfalen bezeichnete. Indes wird diese Bezeichnung vielfach ganz anders gedeutet: von den einen auf die rötliche Farbe des eisenhaltigen Erdbodens, von andern als Hinweisung auf die Gerichtsstätten unter freiem Himmel, so daß die »rote« Erde eben die »rohe, bloße« Erde besagen solle.
Die Vehmgerichte nannten sich Freistühle oder Freigerichte, weil sie das altgermanische Recht der freien Grundbesitzer, Gericht zu halten, sich unangetastet bewahrt hatten. Während nämlich im übrigen Deutschland, abgesehen etwa von den Reichsstädten, die landesherrliche Gewalt mehr und mehr bestrebt war, die alten Freiheiten zu beseitigen und namentlich die Gerichtsbarkeit allein zu üben, behielten die westfälischen Bauern ihr angestammtes Volksgericht und dessen Unmittelbarkeit unter Kaiser und Reich. Der Vorsitzende des Gerichts war kaiserlicher Bevollmächtigter, Karolingischer Graf, und nannte sich, weil er das Grafenamt bei dem Gericht der Freigebliebnen übte, zur Auszeichnung vor andern Grafen: Freigraf; und so hießen die Schöffen am Freistuhl: Freischöffen. Der oberste Stuhlherr, welcher die Gerichtsbarkeit dem Grafen zu Lehen gab, war der Kaiser. Doch übertrug er späterhin die Stuhlherrschaft an den Erzbischof von Köln, welcher fortan die kaiserliche Statthalterschaft über alle Freigerichte in Westfalen besaß.
Solcher Freistühle nun gab es in Westfalen eine große Anzahl. Sie standen meist an den uralten deutschen Malstätten, die schon Karl der Große vorgefunden, in der Regel unter einem alten Baum, einer Linde, einem Hagedorn (Beerboom) und dergleichen, auf einer Anhöhe, von wo aus der Freigraf nicht nur die den Stuhl zunächst umgebenden Schöffen, sondern auch den ganzen »Umstand« des Gerichts, d.h. die zum »Freiding« erschienenen Freien, übersehen und von ihnen gesehen werden konnte. Denn in vielen Fällen wurde öffentlich, ohne daß die »Unwissenden« sich entfernen mußten, gerichtet; und auch das heimliche oder »Stillgericht« tagte an dieser offnen Stätte, welcher dann freilich kein Uneingeweihter sich nahen durfte.
Auf der Malstätte stand gewöhnlich ein steinerner Tisch, welchen von drei Seiten eine steinerne Bank umgab. So wird noch heute unter der sogen. Vehmlinde zu Dortmund, einem der angesehensten Freistühle, der steinerne Tisch gezeigt, auf welchem das Dortmunder Wappen, ein Adler, eingehauen ist, und die Bank von Stein. Die Umgebung trägt noch den an den Königsbann erinnernden Namen: Königshof.
Auf diesem Tische lag bei »gespannter Bank«, d.h. wenn das Gericht gehalten wurde, vor dem Freigrafen ein blankes Schwert und ein Strick aus Weiden geflochten. Auf das Schwert wurden die Eide geleistet. Der Strick aber war das Mittel der Strafvollstreckung. Und damit hängt wohl auch die Benennung »Vehme« (so, und nicht: »Feme« schreiben die alten Urkunden) zusammen. Dieser Ausdruck wird nämlich abgeleitet von vimen, welches soviel als »wyt«, d.h. Weide oder Strang bezeichnet. Der Verurteilte nämlich sollte mit einem aus Weiden geflochtnen Strang gehenkt werden. Auch der Baum, an welchem dies geschah, wurde »Wymen« oder »Vehmen« genannt. Denn die alten Vehmordnungen schreiben vor, daß die Freischöffen den Vervehmten sollen »hängen an des Königs Vemen, das ist an den nächsten Baum, der ihnen dazu bequem ist«.
Vielfach begegnet man der Meinung, es hätte auch außerhalb Westfalens, selbst im südlichen Deutschland und in der Schweiz Vehmgerichte gegeben. Es ist dies aber ein Irrtum. Allerdings mochten in spätern Jahrhunderten einzelne Gerichte in andern Gegenden mit dem Namen Vehmgerichte sich bezeichnen. Allein dies konnte nur durch Mißbrauch geschehn. Sie hatten weder die Vorrechte, noch die Verfassung der Freistühle, und es ist heutzutage außer Zweifel, daß es wirkliche Vehmgerichte nur in Westfalen gegeben hat und nach dem Gang der Geschichte hier allein geben konnte. Aber Freischöffen, d.h. solche, die unter die Genossen der Vehme aufgenommen waren und für den Vollzug der Urteile der Vehme zu sorgen hatten, gab es in ganz Deutschland. Und eben hierauf beruhte die große und geheimnisvolle Macht des heimlichen Gerichts.
Die Vehme wird häufig als ein großer über ganz Deutschland verbreiteter Geheimbund angesehen. Denn die Mitglieder hatten ihre geheimen Erkennungszeichen und waren verpflichtet, einander in Vollzug der Urteile Beistand zu leisten. Gleichwohl standen sie nicht miteinander in einer Verbindung jener Art. Allerdings aber lag die ungemeine und geheimnisvolle Macht der Vehme darin, daß sie durch Mitglieder, durch Schöffen in allen deutschen Ländern sich zu verstärken wußte. Jeder Freischöffe, wo er auch wohnen mochte, und nur ein solcher, konnte wegen eines verübten Verbrechens Klage vor einem westfälischen Freistuhl führen und ein Urteil desselben erwirken, ein Urteil, welches, wenn der Angeklagte sich nicht zu rechtfertigen vermochte, auf Acht und deren Vollzug mittelst des Stranges erging. War aber der Schöffe selbst angeklagt, so hatte er eine weit günstigere Stellung, als der Nichtwissende; in den älteren Zeiten konnte er sich einfach vor dem Freistuhl losschwören; leistete er den Eid, daß er die That nicht begangen, so war er frei. Und auch als späterhin wegen Mißbrauchs dieses zu weit gehende Recht des Losschwörens in Abgang kam, war es doch immerhin dem Freischöffen viel leichter, eine freisprechende Sentenz zu erwirken, als dem Nichtschöffen.
Dazu kamen noch besondre Rechte der Schöffen, welche sie auch außerhalb Westfalens übten, namentlich das Richten auf handhafter That, wovon unten Näheres.
Endlich genoß der Freischöffe eines besondern Schutzes, welcher mächtiger war, als selbst Kaiser und Reich ihn hätte gewähren können. Wer nämlich einen Schöffen, welcher namens der Vehme handelte, verletzte oder auch nur gefangen hielt, mußte der nachdrücklichsten Verfolgung der Vehme gewärtig sein und hatte sein Leben verwirkt.
All diese Vorrechte und die gefürchtete und angesehene Stellung, welche damit verbunden war, ließen das Schöffenamt höchst begehrenswert erscheinen. Die angesehensten Männer aus allen Ständen, selbst viele Reichsfürsten und mancher deutsche Kaiser scheuten nicht die Reise nach Westfalen, um sich dort vor einem Freistuhl »wissend machen zu lassen« und den Eid auf das Schwert des Freigrafen zu leisten. Selbst die mächtigen Reichsstädte legten großen Wert darauf, unter ihren Ratsherren einige Freischöffen der heiligen Vehme zu haben.
Wenn nun eine Ladung oder ein Urteil der Vehme erging, so war jeder Schöffe auf Anfordern eines andern Freischöffen verbunden, zum Vollzug zu helfen. Und da bei dem Geheimnis, in welches die Vehmsache vor jedem Unwissenden gehüllt erschien, kein Schuldiger sicher sein konnte, ob nicht in seiner nächsten Nähe Freischöffen bereit seien, ihn zu fassen, so mußte diese Macht des heimlichen Gerichts in der That eine unwiderstehliche werden.
Häufig versuchten Städte und Landesherren vom Kaiser Privilegien dahin zu erwirken, daß ihre Angehörigen nicht vor einen Freistuhl geladen werden, sondern nur den einheimischen Gerichten unterworfen sein sollten. Solche Privilegien wurden dann wohl dahin erteilt, daß jene Ladung nur zugelassen werde, wenn der Kläger binnen einer gewissen Frist, in der Regel binnen vier Wochen, vor dem einheimischen Gericht Recht nicht zu erlangen vermöge. Und da in jenen Zeiten allgemeiner Rechtsunsicherheit und Gewaltthat sehr häufig die Landesgerichte eines Angeklagten nicht mächtig zu werden vermochten, so blieb trotz jener kaiserlichen Privilegien immerhin die Ladung des Freistuhls in Aussicht.
Treten wir nun nach dieser allgemeinen Charakteristik der Organisation und dem Verfahren der Vehme näher, so ist in betreff der Zusammensetzung des Gerichts selbst schon erwähnt, daß der Vorsitzende ein kaiserlicher Freigraf war. Dieses Amt, das Grafenamt, konnte jeder freie Westfale erlangen, wie denn viele der angesehensten und gefürchtetsten Freigrafen einfache Landleute gewesen sind.
Das Gericht selbst mußte mit mindestens sieben Schöffen besetzt sein. Doch konnte auch über diese Zahl jeder Freigraf und Freischöffe erscheinen und an der Verhandlung und Urteilsfällung teilnehmen, so daß bei manchen besonders wichtigen Sachen oft Hunderte von Freischöffen mitgewirkt haben; z.B. an der Vernehmung des Herzogs Heinrich von Bayern, welche um Johannis 1429 unter dem Vorsitz des Freigrafen Albert Swynde ausgesprochen wurde, beteiligten sich 18 Freigrafen und 800 Freischöffen.
Die Gerichtssitzung fand nur bei hellerlichter Tageszeit unter freiem Himmel statt. Der Frohnbote (»Freifrohne«, »Vehmfrohne«) besorgte die Ladung an die eingesessenen Schöffen (daher die Bezeichnung »gebotenes« oder »verbotenes Ding« d.h. geladenes Gericht) und vollzieht die Aufträge des Freigrafen. Das Verfahren selbst war das altgermanische Anklageverfahren; nur auf erhobene Klage ward gerichtet. Diese Klage geht meist von dem Verletzten oder seinen Angehörigen aus, kann aber nur durch den Mund eines Wissenden vorgetragen werden. Dem Kläger wird, wenn er nicht selbst wissend ist, ein Fürsprecher aus der Zahl der Schöffen bestellt. Hat er nun seine Klage vor dem Freistuhl angebracht, so läßt der Freigraf zunächst darüber entscheiden, ob die Sache eine »Vehmfrage« sei, d.h. ob sie vor das Vehmgericht gehöre. In dieser Hinsicht bezeichnen die ältesten Vehmordnungen als die Verbrechen, für welche die Freigerichte zuständig waren: »Alles, was gegen der Christen Glauben und die zehn Gebote, und was gegen Gott, Ehre und alles Recht ist«; namentlich urteilten sie über Abfall vom christlichen Glauben, Kirchenraub, Verräterei, Mord und Mordbrand, Eigenmacht, Totschlag, Notzucht, Straßenraub, Raub gegen Kranke, Fälschung, Meineid, Dieberei, Landabpflügen, Gewalt gegen Reichs- und Freigerichtsboten. Schließlich waren es überhaupt alle schwereren Verbrechen, über welche sich die Gerichtsbarkeit der Vehme erstreckte. Ob deren Benennung »heilige Vehme« sich auf das Richten über Religionsverbrechen bezog, oder nicht vielmehr darauf, daß sie Gerichtsbarkeit namens des Kaisers und des »heiligen römischen Reichs« übten, mag dahingestellt bleiben.
Nicht vor das Freigericht sollten Juden und Geistliche geladen werden. Die letztern waren bloß ihren geistlichen Gerichten unterworfen. Ein altes Rechtsbuch sagt: »Man soll keinen Pfaffen, auch keinen Geistlichen, der geschoren und geweiht ist, nicht an einen Freistuhl laden, auch kein Weibsbild, noch Kinder, die zu ihren Jahren nicht gekommen sind, auch keinen Juden noch Heiden, noch alle, die den Christenglauben nicht erkannt haben, weil sie des Gerichts nicht würdig sind; die alle soll man nicht an Freistuhl laden.« Im übrigen aber galt keine Befreiung, kein Ansehn der Person: selbst an Reichsstädte und Reichsfürsten erging die unhintertreibliche Ladung, vor dem Freigericht Recht zu geben. Auch über bürgerliche Rechtsstreitigkeiten haben die Vehmgerichte mitunter geurteilt. Doch war bezüglich dieser Rechtsansprüche ihre Zuständigkeit wohl eine beschränkte, einerseits auf westfälische Sachen, anderseits auf die Fälle, in welchen der Berechtigte des Beklagten vor seinem ordentlichen Gericht nicht mächtig werden, vor dem einheimischen Richter desselben kein Recht erlangen konnte (sogenannte Evokationsfälle).
Der Eröffnung des Gerichts gingen gewisse Formalitäten voran, indem in einer Zwiesprache zwischen dem Freigrafen und dem Frohnboten die Ordnungsmäßigkeit des Rechtstages festgestellt wurde. Hierauf ermahnte der Freigraf die Schöffen, sie sollen unparteiisch dem Armen wie dem Reichen »bei ihrer Seelen Pfand« Recht sprechen. Eine Aufzeichnung der Vehmgerichtsordnungen (die sog. Arensberger Reformation nach Th. Berck, Geschichte der westfälischen Vehmgerichte S. 320) sagt des weitern: »Wenn das Gericht bei Königsbann verbannet wird, und man in der heimlichen beschlossenen Acht dinget oder richtet, so sollen aller Häupter bloß und unbedeckt sein. Sie sollen weder Kappen noch Hüte, noch sonst etwas darauf haben, zum Beweise daß sie den Menschen nicht unrecht verurteilen, sondern einzig wegen der Missethat, die er beging. Ihr aller Antlitz soll unbedeckt sein, zum Wahrzeichen, daß sie kein Recht mit Unrecht bedeckt haben, noch bedecken wollen. Sie sollen auch alle bloße Hände haben, zum Zeichen, daß sie kein Werk an und unter sich haben, sondern die Leute nur verurteilen um die Missethat, und daß man die Bösen von den Guten sondert; denn man verurteilt billig einen Dieb und andre wegen Unthat. Sie sollen Mäntelein auf ihren Schultern haben. Diese bedeuten die warme Liebe, recht zu richten, die sie haben sollen; denn so wie der Mantel alle andre Kleider oder den Leib bedeckt, also soll ihre Liebe die Gerechtigkeit bedecken. Sie sollen auch darum die Mäntel auf den Schultern haben, damit sie (anzeigen, daß) sie dem Guten Liebe beweisen, wie der Vater dem Kinde. Sie sollen ferner weder Waffen bei sich führen, noch Harnisch, damit sich niemand vor ihnen zu fürchten brauche, und weil sie in des Kaisers oder Königs und in des Reichs Frieden begriffen sind. Sie sollen endlich auch ohne allen Zorn und nüchtern sein, damit die Trunkenheit sie nicht zu ungerechten Urteilen verleite; denn Trunkenheit macht viel Bosheit.« – Indes steht in teilweisem Widerspruch mit jener Kleiderordnung eine andre Arnsberger Handschrift (bei Wigand, Das Vehmgericht Westfalens S. 551), wonach die Schöffen weder Hut noch Mantel tragen sollen.
Wurde die Vorfrage bejaht, daß die Anklage eine »Vehmwroge« sei, so erließ der Freigraf die Ladung des Angeklagten und des Klägers zur Verhandlung der Klage, und zwar in der Regel mit einer Frist von 6 Wochen und 3 Tagen. War der Vorzuladende ein Freischöffe, so erhielt er drei solcher Fristen. Die letzte Ladung bedrohte den Geladnen, daß, wenn er nun nicht erscheine, auf Erweis der Klage die »höchste Wette« d.h. das schwere letzte Urteil gegen ihn ausgesprochen würde.
Sehr häufig war bei den gerichtlichen Ladungen besondre Vorsicht geboten. Denn oft setzte sich der Ueberbringer einer solchen Ladung der Gefahr aus, von dem übermütigen Geladnen mit blutigem Kopf heimgeschickt zu werden. War solche Vergewaltigung zu besorgen, so konnte die Ladung auch bei Nacht geschehn. So sagen z.B. die von Kaiser Ruprecht über ihr Verfahren vernommenen Freigrafen:
»Sitzt der Angeklagte auf einem Schloß, darein man ohne Sorg und Abenteuer nicht kommen möchte: so mögen die Schöppen, die ihn heischen wollen, eines Nachts oder wenn es ihnen taugt, vor das Schloß reiten, oder gehn, und aus dem Nennbaum oder Riegel drei Späne hauen und die Stücke behalten zum Gezeugnis und den Ladungsbrief in die Kerben oder Grindel stecken und dem Burgwächter zurufen: sie hätten einen Königsbrief in den Grindel gesteckt und eine Urkunde mit sich genommen und er solle dem, der in der Burg ist, sagen, daß er seines Rechtstags warte an dem freien Stuhl bei den höchsten Rechten und des Kaisers Bann.«
Waren Städtebürger zu laden, so wurden die Ladebriefe häufig bei Nacht in die Thore der Stadt oder an die Hausthüre des zu Ladenden gesteckt, oder an einen Ort, wo sie unfehlbar gefunden werden mußten, z.B. in eine Kirche gelegt und dabei noch sorgfältig verwahrt, – in leinenem Säckchen u. dgl.
War der Aufenthalt oder der Wohnort des zu Ladenden unbekannt, so wurden vier schriftliche Ladungen ausgefertigt und an Kreuzstraßen gegen die vier Himmelsgegenden an vier Orten des Landes, worin man etwa seinen Aufenthalt vermuten konnte, aufgesteckt.
Uebrigens ließ die Vehme auch in betreff ihrer Boten sich nicht verachten. Wer einen solchen aufhielt oder verletzte, wurde unnachsichtlich vor Gericht gezogen.
So erging im Jahr 1473 eine Ladung an die Einwohner von Straßburg, weil dortige Bürger zwei Boten der Vehme »auf des heil. Reichs Straße ... mördtlich vom Leben zum Tode gebracht haben«.
Im Jahr 1441 wurden Rat und alle Bürger der Stadt Eßlingen, die über zwanzig Jahre alt, ausgenommen geistliche Leute, vor den Freistuhl zu Waltorf geladen, weil sie einen Freischöffen in Eßlingen gefangen hielten. Und in der That mußten die Eßlinger sich durch abgesandte Prokuratoren vor dem westfälischen Gericht verantworten und die sofortige Entlassung des Gefangnen versprechen. Gar nicht selten waren die Fälle, in denen Reichsstädte, deren Rat oder sämtliche männliche Einwohner vom 20. bis zum 70. Lebensjahre vor einen Freistuhl in Westfalen geladen worden sind, Städte, denen im Weg der Fehde nicht beizukommen gewesen wäre, die sich aber unweigerlich jener Ladung beugen mußten.
In den Zeiten der höchsten Macht und Blüte der Vehmgerichte, namentlich um die Mitte des 16. Jahrhunderts, ergingen ihre Ladebriefe im Süden von Deutschland bis zum Bodensee, östlich bis nach Schlesien und Liefland, im Norden bis zum Meer. Ja, drei Freigrafen wagten sogar, was freilich ein Mißbrauch war, den Kaiser Friedrich III. und seinen Kanzler und sein Kammergericht vor ihren Freistuhl zu laden, damit der Kaiser – wie es in der Ladung hieß – »daselbst seinen Leib und die höchste Ehre verantworte, bei Strafe, für einen ungehorsamen Kaiser gehalten zu werden«.
Die Ladung lautete entweder vor das »offene Ding« (d. h. öffentliches Gericht) oder vor das geheime Gericht. Ersteres war der Fall, wenn der Vorzuladende nicht ein »Wissender« war. Denn der »Unwissende« durfte dem geheimen Gerichte nicht anwohnen. Hingegen über einen »Wissenden« wurde in der heimlichen Acht gerichtet. Erschien nun der Angeklagte vor Gericht, so hatte zunächst der Kläger seine Anklage vorzutragen. War der Angeklagte der That geständig, so hatte er sich selbst gerichtet; ihm wurde sofort das Urteil gesprochen und diesem folgte unmittelbar die Exekution; er wurde ergriffen, gebunden, am nächsten besten Baum aufgeknüpft.
Wenn nun aber der Angeklagte seine Unschuld behauptete, so mußte der Beweis, von der einen oder andern Seite durch Eid geführt werden. Der Ankläger konnte sich erbieten, seine Anklage mit Eidhelfern zu beschwören. Diese mußten Freischöffen sein, und den Eid dahin leisten, daß sie die Anklage für wahr halten. Ob hiefür zwei Eidhelfer genügten, oder deren sechs nötig waren (daher der Ausdruck: »übersiebenen«) ist nicht unbestritten; doch scheinen ursprünglich zwei genügt zu haben. Hatte nun aber der Ankläger mit seinen Eidhelfern sich zum Eid erboten, so konnte der Angeklagte mit einer größeren Zahl von Eidhelfern sich losschwören, also wenn gegen die zwei Eidhelfer des Klägers sechs Schöffen bereit waren, den Eid dahin zu leisten, daß sie die Unschuld des Angeklagten für durchaus glaubhaft halten. Aber diese Eide durfte hinwiederum der Ankläger mit dreizehn Eidhelfern vereiteln, und in diesem Falle konnte der Angeklagte nur mit zwanzig Freischöffen, welche mit ihm zu schwören sich bereit fanden, die Klage überbieten und sich frei machen. Je nach der Zahl der zum Eid bereiten Eidhelfer wurde nun entweder die Anklage oder die Unschuld beschworen. Es lag hierin ein ähnliches Prinzip, wie es den modernen Geschwornengerichten zu Grunde liegt. Es sollte die Ueberzeugung einer Mehrheit von Schöffen und ihr Vertrauen die Frage der Schuld entscheiden.
Nachdem die Anklage und – wenn der Angeklagte erschien, dessen Verantwortung – vernommen, auch die Eide geleistet waren, bestellte der Freigraf einen Schöffen zum Urteilsfinder. Es mußte dies ein dem Angeklagten ebenbürtiger Schöffe sein. Dies nannte man die »Stellung des Urteils auf einen echten rechten Freischöppen«. Dieser hatte die Aufgabe »das Recht zu weisen«. Er konnte sich mit den übrigen Schöffen beraten. Das Urteil mußte aber »sitzend gefunden, stehend gescholten (d.h. verkündigt) werden«. Wurde sein Ausspruch von allen gebilligt, so hieß dies »Folge des Unstandes«. Der hiernach verkündigte Spruch bildete das Urteil, welches nun der Freigraf verkündete und, – wenn es ein Schuldig war, gegen den erschienenen Angeklagten sofort in Vollzug setzte.
Sehr häufig zog der Angeklagte vor, gar nicht vor dem Gerichte zu erscheinen. In diesem Falle nun verwandelte sich das »offene Ding« in die »heimliche Acht« (d. h. geheime Beratung) oder das sog. »Stillgericht«. Dies geschah in derselben Sitzung, auf derselben Malstätte, lediglich dadurch, daß alle Anwesenden, welche nicht Freischöffen waren, durch feierlichen Aufruf aufgefordert wurden, sich zu entfernen. Wenn nach dieser Aufforderung ein Nichtschöffe, ein »unwissender Mann«, und war es auch ohne böse Absicht, an dem Gerichtsort betroffen wurde, so traf ihn unnachsichtlich der Tod: »der Freigraf steht auf, nennt den Mann mit Namen, bindet ihm seine Hände vorn zusammen, thut den Strick aus Weiden um seinen Hals und läßt ihn durch die Freischöffen henken an den nächsten Baum.«
Während nämlich für die Geheimhaltung von Seiten der Schöffen selbst durch den Eid und die strenge Strafe des Verrates gesorgt war, mußte durch diese Heimlichkeit vor Unwissenden Vorsorge getroffen werden, daß nicht etwa der verurteilende Spruch zur Kenntnis des abwesenden Verurteilten kommen und er sich der Exekution entziehen möchte.
Wenn nun also der Angeklagte im letzten Termin, zu welchem er »bei der höchsten Wette« (d. i. Strafe) geladen war, ausblieb, und auf ihn gewartet worden, »bis die Sonne auf dem Höchsten gewesen, bis Mittags in die dritte Uhr«, auch der Kläger dargethan hatte, daß die Ladungen gehörig erfolgt waren, so rief der Freigraf den Angeklagten im Gericht feierlich noch viermal bei Namen und Zunamen auf, und fragte, »ob niemand von seinetwegen da sei, der ihn verantworten wolle zu seinen Rechten und seiner höchsten Ehre«. Und nun forderte der Kläger Vollgericht d. h. die letzte Sentenz, das Endurteil. Er selbst hatte zunächst seine Anklage knieend, die rechte Hand auf des Grafen Schwert gelegt, zu beschwören, und mit dem Kläger, als seine »Folger« oder »Freunde«, seine Eidhelfer aus der Zahl der Schöffen. Diese bestätigten durch ihren Eid, daß sie der Glaubwürdigkeit des Klägers volles Vertrauen beimessen, daß sie überzeugt seien, der Ankläger schwöre »rein, nicht mein«. Damit galt die Anklage gegen den ungehorsam ausgebliebenen Angeklagten als voll erwiesen.
Die Verurteilung, die letzte, die schwere Sentenz wurde in den feierlichsten Formen über den Schuldigen ausgesprochen. Der Freigraf vervehmte ihn, indem er sprach:
»Den beklagten Mann mit Namen N., den nehme ich hier aus dem Frieden, aus den Rechten und Freiheiten, die Kaiser Karl gesetzt und Papst Leo bestätigt hat, und ferner alle Fürsten, Herren, Ritter und Knechte, Freie und Freischöffen beschworen haben im Lande zu Westfalen, und werfe ihn nieder und setze ihn aus allem Frieden, Freiheiten und Rechten in Königsbann und Wette und in den höchsten Unfrieden und Ungnade, und mache ihn unwürdig, echtlos, rechtlos, siegellos, ehrlos, friedelos und unteilhaftig alles Rechts, und verführe ihn und vervehme ihn nach Satzung der heimlichen Acht und weihe seinen Hals dem Stricke, seinen Leichnam den Tieren und Vögeln in der Luft zu verzehren, und befehle seine Seele Gott im Himmel in seine Gewalt, und setze sein Leben und Gut ledig, sein Weib soll Witwe, seine Kinder Waisen sein.«
Hierauf – heißt es in den alten Vehmrechtsbüchern, »soll der Graf nehmen den Strick von Weiden geflochten und ihn werfen aus dem Gerichte, und so sollen dann alle Freischöffen, die um das Gericht stehen, aus dem Munde speien, gleich als ob man den Vervehmten fort in der Stunde henkte. Nach diesem soll der Freigraf sofort gebieten allen Freigrafen und Freischöffen, und sie ermahnen bei ihren Eiden und Treuen, die sie der heimlichen Acht gethan, sobald sie den vervehmten Mann bekommen, daß sie ihn henken sollen an den nächsten Baum, den sie haben mögen nach aller ihrer Macht und Kraft.«
Wer wissentlich mit einem Vervehmten Gemeinschaft hatte, teilte sein Schicksal. So mußte also der Geächtete, verlassen und gemieden, in steter Angst umherirren, bis ihn die Hand des Vollstreckers traf.
Ein so vervehmter Mann, mochte er auch der mächtigste und reichste, der angesehenste und glücklichste gewesen sein, – mit dem Spruch, der über ihn ergangen, war er ein elender, verlorner Mann.
Das Urteil mußte vor dem Vervehmten geheimgehalten werden, damit ihn sicher und unvorbereitet der Vollzug treffen könne. Würde ein Schöffe (denn nur solche waren anwesend gewesen) ihn etwa auch nur gewarnt haben, ihm durch ein verblümtes Wort Vorsicht oder Flucht anratend, z. B. indem er ihm sagte: »es sei anderswo ebensogut Brot essen, als hier,« so war solcher Schöffe als eidbrüchig unrettbar dem Strange verfallen.
Aber wie vermochte das in Westfalen ergangne Urteil in die weite Ferne zu wirken?
Hier eben griff die Heimlichkeit der Vehme mit staunenswerter, unwiderstehlicher Macht ein und verlieh dieser Achterklärung eine Wirksamkeit, welche weit die der kaiserlichen und Reichsacht und Oberacht übertraf. Wer nämlich in die Reichsoberacht erklärt wurde, galt für vogelfrei, jeder durfte ihn töten; aber sehr häufig war es ihm ein Leichtes, sich dieser Gefahr zu entziehen. Aber die Acht oder ›Verfürung‹ der Vehme war in ihren Folgen das unentrinnbare Todesurteil des Vervehmten. Er mußte getötet werden. Denn über ganz Deutschland waren die Freischöffen verbreitet und jeder war durch seinen Eid, den er vor dem Freistuhl geleistet, verbunden, den Spruch der heiligen Vehme durch Tötung des Vervehmten, wo er seiner habhaft werden möge, zu vollziehen. Wenn der Ankläger vor dem Freigericht die Verurteilung seines Gegners erwirkt, oder wenn der Freigraf einen Schöffen oder zwei mit dem Vollzug betraut hatte, so bedurfte es nur der Beiziehung mithelfender Schöffen, welche ja überall zu finden waren, um den Verurteilten zu richten.
Dem Ankläger wurde das Urteil schriftlich mit dem Siegel des Freigrafen und in der Regel mit einer Ermahnung an alle Freischöffen, ihm bei der Vollziehung behilflich zu sein, ausgefertigt, damit ihm die Urkunde zu seiner Legitimation diene gegen andre Freischöffen, die er etwa zur Hilfe bei der Exekution nötig hätte. Denn überall, wo der Vervehmte zu treffen war, konnten und mußten die Schöffen den nichts Ahnenden richten, d.h. sie ergriffen und henkten ihn an den nächsten besten Baum.
Damit aber die Vollstreckung gesichert sei und der einzelne keinen Mißbrauch mache, durften die Freischöffen nur zu dreien den Schuldigen richten. Jeder Schöffe, dem die Vernehmung bekannt war, konnte andre Schöffen zur Hilfe bei der Exekution aufrufen; doch war der Aufgerufene zur Hilfe nur dann, dann aber unbedingt, mag es auch gegen Freund oder Bruder gehen, verbunden, wenn er eines Freigrafen Brief und Siegel sah, oder wenn ihm drei andre Schöffen bei ihren Eiden sagten, daß der Mann vervehmt sei.
Auffallend kann es scheinen, daß der Vollzug des Urteils den Schöffen aufgetragen war, und nicht andern, minder geachteten Personen. Allein in jenen Zeiten wurde diese Funktion nicht, wie späterhin, als eine wenig ehrenhafte betrachtet. Sie galt eben als ein Teil des Richtens selbst; das »Nachrichten« war nur gleichsam der letzte Akt des Gerichtübens. So war auch anderweit, z.B. in manchen Reichsstädten, die Hinrichtung eine Obliegenheit des jüngsten verheirateten Bürgers. Erst späterhin wurde der Henker als anrüchig angesehen, an manchen Orten auch geradezu der »Schelm« genannt. Für die Schöffen der Vehme aber war das Richten des Vervehmten eine durchaus nicht entwürdigende Obliegenheit.
Widersetzte sich der Vervehmte, so durften sie ihn niederstoßen. Sie banden in diesem Falle den Leichnam an einen Baum an der Landstraße und steckten ein Messer daneben, zum Zeichen, daß der Mann nicht von Räubern überfallen, sondern von Freischöffen in des Kaisers Namen gerichtet sei.
In der Regel erfuhr der Unwissende, daß er vervehmt sei, erst in dem Augenblicke, da ihm der Strang um den Hals gelegt wurde.
Um andre Schöffen in der Nähe des Verurteilten in aller Stille und ohne sich zu verraten oder preiszugeben, zur Mitwirkung auffordern zu können, und um sicher zu sein, nicht dabei an einen Unwissenden zu kommen und dadurch das Geheimnis zu verraten, hatten die Freischöffen eine geheime Losung, an der sie sich gegenseitig erkannten, und welche zugleich das Mittel war, jeden Nichtschöffen, der sich etwa in ihre Gerichte eindrängen wollte, als solchen sogleich zu erkennen.
Der Freigraf sagte nämlich den Neuaufgenommenen mit bedecktem Haupte »die heimliche Vehme Strick, Stein, Gras, Grein«Das altnordische Wort Grein – Ast oder Zweig, deutet auf den Baum, an welchem das Todesurteil vollstreckt wurde. Vgl. Grimm, Rechtsalterthümer, S. 683. und erklärt ihnen das. Dann sagt er ihnen das »Notwort, wie es Carolus Magnus der heimlichen Acht gegeben hat, zu wissen: Reinir dor Feweri und klärt ihnen das auf, als vorgeschrieben ist«; dann lehrt er ihnen den heimlichen Schöppengruß also: daß der ankommende Schöppe seine rechte Hand auf des andern linke Schulter legt und spricht: »Ich grüß euch, lieber Mann! was fanget ihr hier an?« Darnach legt der Angeredete seine rechte Hand auf des andern Schöppen linke Schulter und spricht: »Alles Glücke kehre ein, wo die Freienschöffen sein.« Der erste sagt nun: »Strick, Stein« und der andre erwidert: »Gras, Grein«. Auch wurde, wenn besondre Veranlassung vorlag, das Notwort ausgesprochen.
Ein Erkennungszeichen zwischen Wissenden soll auch darin bestanden haben, daß sie bei Tische »das Messer mit der Spitze zu sich und die Schale nach der Schüssel von sich gekehrt haben«.
Wer vor dem Freistuhl zum Wissenden (daher auch »Vehmenoten« genannt) gemacht wurde, hatte den feierlichen Eid dem Freigrafen nachzusprechen: »Ich gelobe, daß ich nun fort mehr die heilige Vehme wolle helfen halten, und verheelen vor Weib und Kind, vor Vater und Mutter, vor Schwester und Bruder, vor Feuer und Wind, vor alle demjenigen, was die Sonne bescheint und der Regen bedecket, vor alle dem, was zwischen Himmel und Erde ist, befördern vor den Mann, so das Recht kann; und will diesem freien Stuhl, darunter ich gesessen bin, vorbringen alles, was in die heimliche Acht des Kaisers gehört, was ich für wahr weiß, oder von wahrhaften Leuten habe hören sagen, das zur Rüge oder Strafe gehet, das Vehmwrogen sein, auf daß es gerichtet oder mit Willen des Klägers in Gnaden gefristet werde; und will das nicht lassen um Lieb noch um Leid, um Gold, noch Silber, noch um Edelgestein; und stärken dies Gericht und Recht nach allen meinen fünf Sinnen und Vermögen ec.
Auf den Verrat der geheimen Losung und der Heimlichkeiten des Gerichts überhaupt stand unnachsichtlich der Tod. So sagt ein altes Rechtsbuch der Vehme:
»Wäre es, daß ein Freischöffe die Heimlichkeit und Losung der heimlichen Acht oder irgend etwas davon in das Gemeine brächte oder unwissenden Leuten einige Stücke davon, klein oder groß, sagte, den sollen die Freigrafen und Freischöffen greifen unverklagt und binden ihm seine Hände vorne zusammen und ein Tuch vor seine Augen und werfen ihn auf seinen Bauch und winden ihm seine Zunge hinten aus seinem Nacken und thun ihm einen dreisträngigen Strick um seinen Hals und hängen ihn 7 Fuß höher als einen verurteilten, vervehmten, missethätigen Dieb.«
Diese furchtbare Drohung erklärt es denn auch, daß kein Fall bekannt ist, in welchem ein Wissender sich hätte bewegen lassen, die Geheimnisse der Vehme zu verraten. Ja die Scheu, in diese Geheimnisse einzudringen, war bei den »Unwissenden« so groß, daß sie nicht wagten, auch nur eine Vehmurkunde zu eröffnen, welche die Aufschrift trug: »Diesen Brief soll niemand öffnen, niemand lesen oder hören lesen, es sei denn ein echter rechter Freischöffe der heimlichen beschlossenen Acht des heiligen Reichs.« Solche Urkunden fanden sich daher noch in unserm Jahrhundert unentsiegelt in den Archiven vor, weil niemand dem furchtbaren Rächer des Geheimnisses in die Hände hatte fallen wollen.
Dasselbe Geheimnis umgab die Gesetze und Gebräuche der Freigerichte. Die Aufzeichnungen und Sammlungen derselben tragen außen und zum Eingang die Warnung, daß niemand sie haben oder lesen dürfe, es sei denn ein echter, rechter, freier Schöffe des heiligen römischen Reichs. Wer aber, ohne daß er ein Freischöffe wäre, das Buch eröffne, der solle des schweren heimlichen Gerichts gewärtig sein. Und in der That blieb das Geheimnis vor allen Nichtschöffen gewahrt, so sehr, daß häufig der geladne Angeklagte aus Unkunde der Einrichtungen in großer Furcht sich befand, ob er nicht aus Unkenntnis in Nachteil gerate. So z.B. wird berichtet, daß die Stadt Görlitz und fünf andre Städte in der Lausitz, als sie im Jahr 1428 vor einen Freistuhl geladen wurden, in größte Angst gerieten und selbst nach Erledigung der Sache sich noch nicht sicher glaubten, und daher durch einige zuverlässige Personen Kunde von der Uebung und Einrichtung der Vehmgerichte, wiewohl vergebens, einzuziehen sich bemühten.
Einige besonders angesehene Freigerichte hießen Oberhöfe oder Oberstühle, indem sie eine höhere Autorität in Vehmrechtsfragen in Anspruch nahmen, und es scheint, daß hie und da an sie von andern Freistühlen eine zweifelhafte Sache abgegeben oder ihr Rat in Vehmfragen eingeholt wurde. Eine eigentliche Berufung aber, so daß der Verurteilte die Sache noch an ein höheres Gericht hätte bringen können, gab es der Natur der Sache nach – wie denn jedem Urteil die Vollstreckung alsbald folgen sollte – nicht. Wohl aber mochte gegen eine unbefugte Ladung Beschwerde an den Kaiser erhoben werden. Auch konnte ein abwesend Verurteilter, wenn er sein Ausbleiben auf die an ihn ergangne Ladung zu entschuldigen wußte und wenn er ein Wissender war, um neue Verhandlung der Sache bei dem Freistuhl, welcher das Urteil gesprochen hatte, nachsuchen. Zu diesem Behuf mußte er im heimlichen Ding mit einem Strick um den Hals in Begleitung zweier Freischöffen erscheinen und fußfällig um Gnade bitten.
Ein Zusammentritt der Freigrafen mit dem Stuhlherrn kam bei den sogenannten Generalkapiteln vor, bei welchen indes auch die einfachen Freischöffen zugelassen waren und deren oft gegen tausend erschienen. Sie hatten namentlich die Aufgabe, die Vehmrechtsnormen fest- und klarzustellen und die Freistühle zu beaufsichtigen.
Nicht nur für die Vollstreckung der Urteile, auch für die Entdeckung und Verfolgung von Verbrechen war die Verbreitung der Schöffen von hohem Belang. Denn sie hatten eine allgemeine Rügepflicht, sie waren verbunden, sei es auf Ansuchen des Verletzten, sei es aus eigner Wahrnehmung, solche Verbrechen, die nicht sonst ihren ordentlichen Richter fanden, vor einem Freistuhl auf roter Erde zur Anklage zu bringen. Ja, in gewissen Fällen konnten sie sofort richtend gegen den Verbrecher, wer es auch sei, einschreiten, kraft ihrer sehr weitgehenden Machtvollkommenheit »bei handhafter That«.
Wurde nämlich von Freischöffen der Vehme der Verbrecher entweder auf der That selbst ergriffen oder mit den Werkzeugen, mit denen er die That vollbrachte, oder mit dem, was er durch die That sich angeeignet, auf eine Weise betreten, die ihn ganz unverkennbar als Thäter bezeichnete, oder wenn er die That gestand – die Vehmurkunden nennen es: »mit habender Hand, mit blinkendem Schein (evidenter That) oder mit gichtigem (bekennendem) Mund« – so konnte sogleich und wo auch der Verbrecher auf der That ergriffen werden mochte, also auch außerhalb Westfalen, gerichtet werden. Denn trafen nur drei Freischöffen jemand bei einem Verbrechen, das als Vehmsache galt, auf handhafter That: so konnten und mußten sie ihn zur Stunde richten, d. h. sie ergriffen ihn und henkten ihn an den nächsten Baum.
Da die Vehmrechtsgewohnheiten auch den »gichtigen Mund«, das Geständnis des Angeklagten, zur handhaften That zählen; so folgt daraus, daß, wenn drei oder vier Schöffen von einem dritten außergerichtlich das Bekenntnis eines Verbrechens hörten, sie sofort ihn richten konnten.
Wenn sich also einer in Gegenwart mehrerer Schöffen eines Verbrechens berühmte, so konnten gegen ihn die Freischöffen auf der Stelle mit dem Strang vorgehen. Es war dies ein höchst gefährliches Recht; denn selten mögen die Schöffen wohl die Ernstlichkeit des Geständnisses untersucht haben, sondern schritten eben mit der Exekution ein.
Einen solchen Fall berichtet eine alte Chronik von Thüringen und Hessen. Als im Jahr 1412 Kaiser Rupert nach Hersfeld kam, so hielt er den jungen Ritter Simon von Waldenstein vorzüglich hoch. Simon kam mit achtzehn grauen Hengsten und war mit allen seinen Dienern ganz weiß gekleidet. Wie er nun mit dem König und vielen Fürsten und Herren zu Tische saß, da sprach einer im Mutwillen, der war dem Simon feind: »wie pranget der von Waldenstein so hoch, ich habe ihm wohl vier Pferde genommen, und floge nicht ein Vogel darnach.« Das wurde dem Simon angesagt und er antwortete: »hätte er geschwiegen, so wäre es mir unbekannt gewesen; haben nicht Vögel darnach geflogen, so sollen nun große Raben fliegen!« und nahm denselben sobald vom Tisch, führte ihn hinaus und ließ ihn an einen Baum henken, »das war sein verdienter Lohn seines schwatzhaften Mauls wegen«. »Man sagt – fährt der Bericht fort – von diesem Simon, daß er schon früher vierundzwanzig um ihrer Untugend willen henken lassen, feldflüchtige, treulose und hängmäßige Böswichter, die wider Ehr und Ehrbarkeit thäten, sonderlich an Frauen und Jungfrauen; was ihm deren zukam, ließ er alle henken, keine Schande oder Untugend mochte er geleiden. Da war auch Zucht und Ehr unter dem Adel. Denn jedermann forchte die schnelle Straf.«
Das Recht der Freischöffen, einen Verbrecher sofort vom Leben zum Tode zu bringen, wurde freilich nicht selten mißbraucht. So geschah es von Herzog Ulrich von Württemberg in seinem Handel mit Hans von Hutten. Der Herzog lebte mit seiner Gemahlin, der Herzogin Sabine in vielfachem Hader; sein Vertrauter, Hutten, erfreute sich der Gunst der Herzogin. Auf einer Jagd im Schönbuch, da Hutten einen von der Herzogin ihm geschenkten Ring trug, ließ der Herzog, der neben Hutten ritt, sein Gefolge sich entfernen und fiel nun plötzlich über seinen Vertrauten her und stieß ihn mit dem Schwert nieder; hierauf zog er demselben den Gürtel ab und knüpfte ihn damit eigenhändig an eine Eiche. Zu seiner Rechtfertigung erklärte der Herzog, er habe als westfälischer Freischöffe den missethätigen Junker gerichtet. Allein die Eigenschaft als Schöffe würde ihn hierzu nur bei handhafter That oder gichtigem Mund und nur mit Zuziehung zweier weitern Schöffen berechtigt haben. Die That erregte allgemeinen Unwillen und auf Betreiben der Huttenschen Verwandten fand sich der Kaiser schließlich bewogen, über den Herzog die Acht auszusprechen.
Eine dreifache Wirksamkeit war es, welche die Freischöffen im ganzen deutschen Reiche zum Schrecken aller Missethäter Jahrhunderte lang mit unerbittlicher Strenge übten. Wo sie von einem Verbrechen Kunde erhielten, welches nicht etwa schon vom einheimischen Gericht geahndet worden, mußten sie die Anklage vor den Freistuhl bringen. Hatte dieser die Acht ausgesprochen und einen Mann vervehmt, so konnte jeder Schöffe in der Nähe des Vervehmten angehalten werden, denselben zu richten. Wer aber auf frischer That oder auch nur derselben nachher geständig von Schöffen betroffen wurde, den konnten und sollten sie sofort selbst vom Leben zum Tode bringen. Erwägt man nun die große, allmählich auf gegen hunderttausend gestiegne Zahl von Schöffen, ihre Verbreitung und Organisation, so muß ihre Bedeutung in der That als eine gewaltige erscheinen.
Die Freischöffen bildeten durch ihre Stellung zur Vehme gewissermaßen eine selbständige Macht im Reiche, geeint zum Schutz des Rechts und der Unterdrückten gegen alle groben Verbrecher, ein Hort der Verfolgten, ein Schrecken für den Uebermütigen.
Der kaiserliche Blutbann, welchen die Freigerichte in Westfalen handhabten und kraft dessen sie eines jeden Missethäters im ganzen Reiche mächtig zu sein erklärten, er blieb keine leere Drohung, wie so manches Gesetz jener Zeit. Dem Wort folgte die That, und der Ruf vollstreckter Vehmsprüche durchzog alle Lande und beugte selbst den Trotz des Faust- und Fehderechts.
Ein ausgezeichneter Forscher über Vehmgerichte (Wigand, 1825) sagt: »Keine andre Einigung und Verbindung kam dieser gleich. Was gerüstete Heere nicht vermochten, wirkte hier der Ausspruch des Rechts. Der Fürst oder Graf, der an der Spitze seiner gerüsteten Mannen und hinter den festen Mauern seiner Burg selbst dem Kaiser trotzte, war entwaffnet, wenn der Bund, dem er nicht entrinnen konnte, ihn zum Opfer erkoren hatte. Selbst ein trotziger Ritter verschmähte sorglos das Gebot eines kaiserlichen Hofgerichts, das in den ersten Städten des Reichs, in kaiserlichen Palästen seine Sitzungen hielt; aber Städte und Fürsten erbebten, wenn ein Freigraf sie an die alten Malplätze, unter die Linde, oder an eines Flüßchens Ufer, auf westfälischen Boden heischte. Der gerichtlichen Gewalt sich zu entziehen und dem Urteilsspruch zu entgehen, war ein leichtes in jener Zeit. Aber wer vom Freigericht gerichtet war, konnte nirgend entfliehen. Ganz Deutschland war der Schöffen Land, und wo er sich befand, war er mitten unter seinen Richtern. Wie man von einer eisernen Jungfrau erzählt, zu der der Verurteilte geführt wurde, und die auf einen Druck, wenn er sich ihr nahte, ihn in ihre Arme schloß und mit scharfen Messern zerschnitt und vernichtete; so war auch das Urteil der Vehme, das der Ankläger heimlich bei sich trug, dem Zauberdruck zu gleichen, der, wenn er den Verurteilten berührte, ihn rettungslos in die zermalmenden Arme der Vehmgenossen stürzte.«
Es waren nicht gelehrte Richter, sondern meist einfache Landleute, welche dies in ihrem Volksgericht vollführten. Und welcher Kontrast gegen die mittelalterliche Justiz der Fürsten und Städte! Die Vehme kannte kein inquisitorisches Verfahren, ließ nie den Verdächtigen im Kerker schmachten, hat nicht ihn durch Folter oder durch geschraubte Fragen zum Geständnis getrieben und ihrer Strafe blieb all die Grausamkeit der verstümmelnden Strafen und der geschärften Todesstrafen ferne.
In Zeiten der allgemeinen Rechtsunsicherheit war die Vehme in der That ein Hort des Rechts, ein mächtiger Schutz der durch Gewalt Bedrohten, der Redlichen Schutz, der Frevler Trutz.
Aber es darf auch die Kehrseite des Bildes nicht verschwiegen werden. Wie alle menschlichen Institutionen, so groß und wohlgemeint sie sein mögen, so war auch die Einrichtung der Vehme im Laufe der Jahrhunderte einer Entartungausgesetzt, welche schließlich ihren Untergang herbeiführen mußte und in groben Mißbräuchen das ursprünglich so makellose Freigericht in Mißkredit brachte. Der Schöffenstand wurde nach und nach korrumpiert, wohl auch mit infolge der massenhaften Aufnahme der sich Meldenden aus allen Gauen des Reichs. Während in den ersten Jahrhunderten streng darauf geachtet worden, daß man nur Männer von verbürgter Ehrenhaftigkeit und voller Zuverlässigkeit zu Freischöppen mache, so ließen sich späterhin manche Freigrafen durch Geld oder Einfluß eines Mächtigen bestimmen, die nötige Prüfung zu unterlassen, und danach drängten sich in die Reihen nicht nur der Schöffen, auch der Freigrafen, Leute von zweifelhaftem Charakter. Bestechung oder Haß wirkten bei dem Richterspruch mit. »Ein korrumpierter Freigraf stellte das Urteil an einen parteiischen Schöppen, welchem ein ebenso parteiischer Umstand dasselbe finden half. Die Stuhlherrschaft sah durch die Finger, weil sie selbst das ihrige von den Einkünften (den Gebühren für die Aufnahme und den Gerichtskosten, welche die Partien zu leisten hatten) zog. Um die gesetzlichen Befreiungen kümmerte man sich wenig oder gar nicht mehr. Man maßte sich ohne weiters Kompetenz über bloße Zivilsachen an.«
Die Mißbräuche, welche zu den vielfachsten Beschwerden Anlaß gaben, veranlaßten den Kaiser, daß er einer Reihe von Städten das Privilegium erteilte, nicht mehr vor ein Freigericht geladen werden zu können. Solche Exemtionen wurden bald auf ganze Territorien erstreckt. Mit der Erstarkung der landesherrlichen Gewalt und der Besserung in der allgemeinen Rechtssicherheit war ohnehin die innere Berechtigung der westfälischen Jurisdiktion für das übrige Deutschland gefallen. So schwand denn auch ihre Bedeutung schon im Lauf des sechzehnten Jahrhunderts fast völlig dahin. Die Vehmgerichte sind nie durch allgemeines Gesetz abgeschafft worden, aber die Geschichte hat ihren Niedergang und ihr Erlöschen zu verzeichnen, denn sie hatten ihren Dienst gethan.